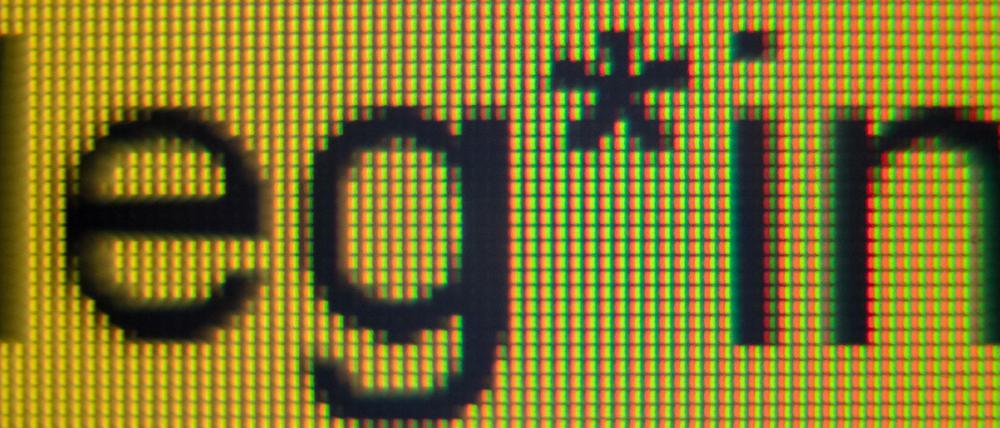
© Sebastian Gollnow/dpa
Geschlechtergerechte Sprache im Gericht: Urteile werden im Namen des Volkes verkündet – nicht im Namen von Politik
Solange es keine festen Regeln gibt, werden durch Gendern oder Nichtgendern politische Positionen offenbar. Das tut der Justiz nicht gut. Ein Kommentar.

Zur Gretchenfrage der gesellschaftspolitischen Gegenwart in Deutschland, der alle Geschlechter umfassenden Schreibweise, ist die Politik eher schweigsam. Die Altpartei AfD ist dagegen, notorisch Fortschrittliche wie Linke/Grüne sind dafür, die SPD ist irgendwo dazwischen, und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet rät zur Gelassenheit. Was Konservative eben raten, wenn ihnen nichts einfällt.
„Sprache entwickelt sich“, lautet eine Einsicht, die die Situation jedoch unzureichend beschreibt. Derzeit wird sie entwickelt, von Medien, Politiker:innen, Interessengruppen, ambitionierten Behördenvertretenden. Die Wortendung „innen“, gesprochen oder im Schriftkontext mit Stern oder Doppelpunkt, prägt Nachrichten, Reportagen, Formulare, Gespräche. Es herrscht ein neuer Sound.
Was die Exekutive darf, wird bei der Judikative fraglich
Im Prinzip macht bislang jede und jeder, was sie oder er will. Das kann man unter Aspekten der Vielfalt begrüßen. Eine Vielfalt, die sich auch in den Ämtern spiegeln darf: Die Exekutive hat Gleichheit zu achten und Neutralität zu wahren. Unpolitisch ist sie nicht. Wer an der Spitze steht, entscheidet, auch über Formfragen. Chef oder Chefin sind verantwortlich. Man kann sie ja abwählen.
[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Gretchenhafter stellt sich die Frage vor Gericht. Derzeit unterliegt es richterlicher Freiheit, die angemessene Geschlechterform zu wählen oder etwa das unter Jurist*innen beliebte Wort „jedermann“ zu tilgen. Doch es fällt eben auf, dass gewählte Sprachvarianten zuweilen mit politischen Weltsichten harmonieren, wie sie in Richterinnensprüchen durchaus aufscheinen können. Ein aktueller Fall ist der Beschluss des Berliner Arbeitsgerichts zu einem mutmaßlichen Fall von Rassismus im KaDeWe, Stichwort Ming-Vase. Die explizite Nennung von „Kolleg:innen“ und Mitarbeiter:innen“ fügt sich dort in allerlei Rassismusdiagnosen, die es unwahrscheinlich machen, dass die Person, die ihn verfasst hat, Alexander Gauland für eine Hoffnung hält.
Ist es reaktionär, sich dem Neusprech zu verweigern?
Man kann das alles, wie Armin Laschet, gelassen sehen. Aber ist es gerecht? Die Wahlfreiheit kann erkennbar machen, was manchmal besser verborgen bliebe: Weltanschauungen oder politische Präferenzen von Richtenden. Sich im schriftlichen Urteil dem Neusprech zu verweigern, lässt dann möglicherweise auf reaktionären Starrsinn schließen, während eine Kaufhausangestellte, der man Rassismus vorwirft, bei einem Gender-Richter eher schlechte Karten hätte. Aufmerksame Anwältinnen und Anwälte werden hier schon so langsam ihre Pappenheimer: innen kennen.
Die Freiheit hat deshalb eine Kehrseite. Sie zwingt in eine Position. In der Politik mag das eine schöne Sache sein. In der Justiz verdient es Skepsis. Gerichten sichert es ihre Unabhängigkeit und Autorität, die Individuen eines Richtergremiums als „Spruchkörper“ mit festen Formen erscheinen zu lassen. Man kann Urteile auch gendern. Aber wenn, dann nach gleichen Regeln. Und alle.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false