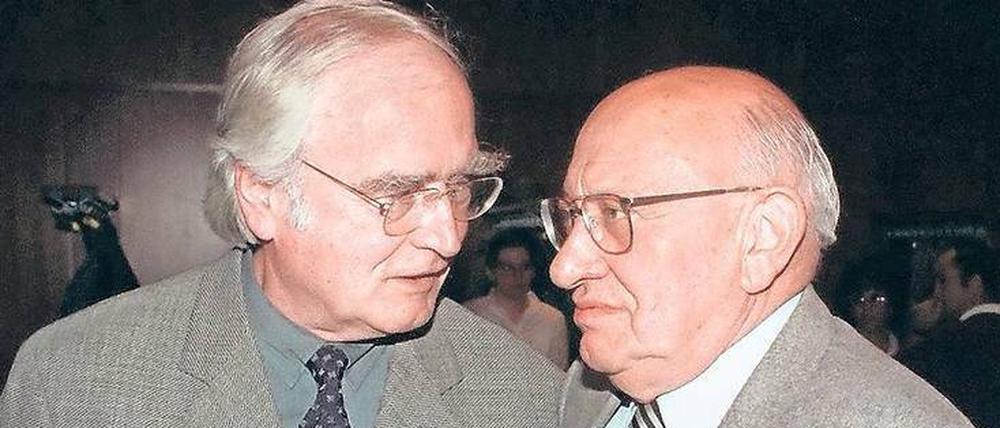
© Fabian Matzerath/dpa
Studie zum Schlüsselroman: Bist du es wirklich?
Zur Kenntlichkeit entstellt: Der Schlüsselroman hat keinen guten Ruf. Er gilt als indiskret. Literaturwissenschaftler Johannes Franzen erkundet seine Geschichte.
Alle Personen seines Exilromans „Mephisto“, wollte Klaus Mann in einem Nachsatz glauben machen, „stellen Typen dar, nicht Personen“. Das hat den Bundesgerichtshof nicht daran gehindert, die geplante deutsche Ausgabe auf Antrag des Adoptivsohns von Gustav Gründgens zu verbieten. Der BGH sah das postmortale Persönlichkeitsrecht seines Vaters trotz der durchsichtigen Verschlüsselung seines Namens als Mephisto-Darsteller Hendrik Höfgen verletzt. Er wertete das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen sogar höher als die Kunstfreiheit nach Artikel 5, Abs. 3 des Grundgesetzes. Dabei blieb auch das Bundesverfassungsgericht, allerdings mit der Einschränkung, das postmortale Persönlichkeitsrecht schwinde mit den Jahren, in denen die Erinnerung an die Person des Verstorbenen verblasse. Tatsächlich erschien bei Rowohlt 1981 eine Ausgabe ohne erneute Gegenklage.
Noch entschiedener gingen die Gerichte gegen Maxim Billers Roman „Esra“ vor, durch den sich die frühere Freundin des Autors bloßgestellt fühlte, zumal Biller in einem privaten Widmungsexemplar die Identität „Esras“ mit ihr eingeräumt hatte. So verfing seine Schutzbehauptung nicht, reale Personen hätten ihm nur „als Anregung für die vertypten Romanfiguren“ gedient. Das Bundesverfassungsgericht beschied 2007 auch seine Beschwerde gegen das Verbot damit, der Schutz der Intimsphäre stehe über der missbrauchten Kunstfreiheit. Übrigens ebenfalls mit einer Einschränkung, die den geforderten Schadensersatz für die Klägerin ablehnte.
Nicht immer landeten Schlüsselromane vor ordentlichen Gerichten, sondern zumeist nur vor dem Moralgericht der Literaturkritik. Wohl deshalb nennt der junge Bonner Literaturwissenschaftler Johannes Franzen seine Studie „Indiskrete Fiktionen. Theorie und Praxis des Schlüsselromans 1960–2015“ ein Sittengemälde des Feuilletons seit den 1960er Jahren. Das ist sie auch, wenn sie die Feuilletonschlachten um echte und vermeintliche Schlüsselromane rekapituliert wie Thomas Bernhards „Holzfällen“ (in dem sich der Komponist Gerhard Lampersberg porträtiert fühlte), Martin Walsers „Tod eines Kritikers“ (über Marcel Reich-Ranicki), Klaus Rainer Röhls „Die Genossin“ (über seine Ex-Frau Ulrike Meinhof) oder Hellmuth Karaseks „Das Magazin“ (über den „Spiegel“). Manchmal outen sich Figuren auch selber: So gab die „FAZ“ Alexander Gauland 1996 die Gelegenheit, sich in einer Rezension von Martin Walsers Roman „Finks Krieg“, der in ebendieser Zeitung vorabgedruckt worden war, zu erklären: „Ich war Tronkenburg“ – das literarische Pseudonym jenes damaligen hessischen CDU-Staatsekretärs, der 1989 durch die Versetzung eines SPD-Ministerialrats für die „Affäre Gauland“ gesorgt hatte.
Schwanken zwischen Fiktion und Fakt
Johannes Franzen will mehr, als der hitzigen Debatte um Wert und Unwert des Schlüsselromans die Temperatur zu messen, indem er als Literaturwissenschaftler dessen Gattungsgeschichte und sein begriffliches Schwanken zwischen Fiktionalität und Faktualität untersucht. Die Gattungsgeschichte des Schlüsselromans ist jung, als Begriff taucht er erst Ende des 19. Jahrhunderts in Fernand Drujons Werk „Les livres à clef“ (1888) auf, die deutsche Literaturwissenschaft kennt ihn erst aus den Kompendien und Monografien von Georg Schneider („Die Schlüsselliteratur“, 3 Bde. 1951–53) und Gertrud Maria Rösch („Clavis Scientiae“, 2004). In das Gattungsschema der Literaturwissenschaft will er aber nicht recht passen, Franzen hält ihn eher für einen Denunziations- als einen Gattungsbegriff.
Er habe, bekennt er am Ende, auch gar nicht die Absicht gehabt, den Schlüsselroman als Gattung zu rehabilitieren. Aber er nimmt ihn auch gegen seine Abwertung als Missbrauch der Fiktionalität von Literatur („pseudokünstlerische Indiskretion“) in Schutz, wenn die Kritikerin Sigrid Löffler Bernhards „Holzfällen“ durch den Skandal seiner Entschlüsselung für „so gut wie unlesbar“ erklärte.
Die meisten Schlüsselromane sind Mischformen aus Bekenntnis und Satire
Das hält Franzen durch die Rezeption unprofessioneller Leser für widerlegt, die dem Doppelcharakter des Schlüsselromans zwischen Fiktion und Faktizität besser gerecht werde als das Beharren einer elitären Literaturkritik, die auf der „reinen“ Fiktionalität als Kriterium der Hochliteratur beharrt. Die meisten als Schlüsselroman geschriebenen und gelesenen Romane seien Mischformen aus autobiografisch-privaten Bekenntnissen und auf Öffentlichkeit angelegten Personalsatiren an der Grenze zwischen Authentizität und Fiktion.
Ein wenig zu kurz kommt bei Franzen, dass es auch unumstrittene Schlüsselromane wie Robert Wolfgang Schnells Berliner Roman „Geisterbahn“ gibt, der im Untertitel der ersten Auflage „Ein Nachschlüssel zum Berliner Leben“ hieß, in der zweiten nur noch „Kreuzberger Ballade“. Dabei wäre es wissenswert, ob sein Autor wegen des schlechten Rufs der Gattung auf die Bezeichnung als Schlüsselroman verzichtet hat.
Sie scheint ihm zumindest nicht geschadet zu haben, nachdem er es zu weiteren Auflagen brachte und seine Figuren – etwa der Maler Arthur Märchen – sogar zu bescheidenem Nachruhm. Schnell selbst hat die Dialektik des Schlüsselromans in einem Nachsatz positiv gewendet: Sein Buch sei nicht „die Darstellung einer vorhandenen Welt, sondern das heutige Kreuzberg hat immer von Neuem begonnen, sich der ,Geisterbahn‘ nachzubilden“.
Johannes Franzen: Indiskrete Fiktionen. Theorie und Praxis des Schlüsselromans 1960-2015. Wallstein Verlag, Göttingen 2018. 456 Seiten, 39,90 €.
Hannes Schwenger
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false