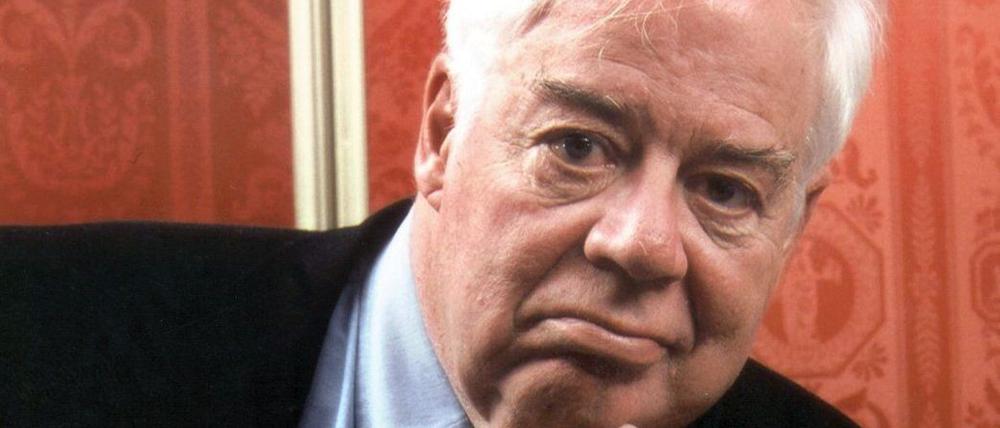
© picture-alliance / dpa/DPA PICTURE-ALLIANCE / DB IDENTITY FOUNDATION
Richard Rortys Philosophie für den Wandel: Der Demokratie hilft Wahrheitssuche nicht weiter
Universelle Werte? Für den US-Philosophen Richard Rorty taugen sie nicht als politischer Kompass. Warum Demokratien mehr auf soziale Kooperation als auf Dogmen setzen sollten, legt er in seinen neu erschienenen Vorlesungen dar.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Elternteil mit der Familie im Atomschutzbunker. Würden Sie ihre Lebensmittel mit den ärmeren Nachbarn teilen, die kaum noch Vorräte haben? Im ersten Moment mag man denken: Selbstverständlich, das fordert die Nächstenliebe! Im zweiten: Auf keinen Fall, für die eigenen Kinder sorgen geht vor.
In die Zwickmühle dieses Gedankenexperiments führte der US-Philosoph Richard Rorty (1931-2007) im Juni 1996 die Zuhörer seiner Vorlesung an der Universität Girona, um einmal mehr den Ausgangspunkt seines politischen Denkens zu vermitteln. Der lautet in etwa: Um den Weg zur bestmöglichen Gesellschaft zu finden, hilft es kaum weiter danach zu fragen, was universell gültig und moralisch richtig ist.
Warum wir uns von einem solchen Streben nach der letzten Wahrheit gerade der liberalen Demokratie zuliebe verabschieden sollten, legte Rorty ausführlich in den Girona-Vorlesungen dar. Unter dem Titel „Pragmatismus als Antiautoritarismus“ sind diese jetzt erstmals in deutscher Übersetzung erschienen.
Schon Ende der 1960er stellte Rorty seine Disziplin durch sprachliche Dekonstruktion auf den Kopf und regte an, die Weisheitslehre eher an sozialen denn an ideellen Fragen auszurichten. In der späten Vorlesungsreihe in Italien führte er dann überzeugend vor, wie Erkenntnistheorie - also unser Verständnis davon, wie wir die Welt wahrnehmen und Wissen schöpfen - sich letztlich entscheidend darauf auswirkt, wie wir Politik machen.
Erkenntnistheorie ist politisch
Dafür unternimmt Rorty einen analytischen Ritt durch die Philosophiegeschichte: von Metaphysikern wie Platon und Immanuel Kant über Friedrich Nietzsche, der den Einfluss der Sprache auf unser Weltbild stark machte, bis hin zu frühen Vertretern des Pragmatismus wie William James und John Dewey, auf denen seine am kollektiven Handeln orientierte Theorie fußt.
Obgleich vor fast 20 Jahren entstanden, bieten seine Überlegungen einige Anknüpfungspunkte für heutige Debatten darüber, wie wir globalen Krisen begegnen können, auf die es keine einfachen Antworten gibt und wo jeder Lösungsansatz mit neuen Konflikten einhergeht. Der „pragmatistische“ Ansatz, für den Rorty steht, geht nämlich zum einen bereits davon aus, dass Gesellschaft erst entsteht, wenn wir Probleme lösen müssen. Zum anderen rechnet er ein, dass wir - wie das Eingangsbeispiel veranschaulicht - als soziale Wesen dabei in Loyalitätskonflikte geraten.
Mit der typischen Mischung aus Ironie und Ernst und provokant zugespitzten Beispielen kommt Rorty in den Vorlesungen zunächst immer wieder auf seinen Hauptkritikpunkt zurück: Westliche Denker, so auch Jürgen Habermas, tappten bis heute in die Falle, Sprache und Handeln, Ideale und politische Praxis, Vernunft und Gefühl als Gegenspieler zu verstehen. Und hielten damit an der eigentlich seit der Moderne überkommenen, letztlich autoritären Vorstellung fest, es gäbe etwas, das unsere Erfahrung übersteige, sei es Gott oder die Wissenschaft.
Dass es bis heute schwerfällt, sich von dem Glauben an Wahrheit zu lösen, ist angesichts globaler Krisen und gesellschaftlicher Konflikte verständlich. Müssten wir Wahrheit und universelle Werte angesichts von Fake News, Klimaleugnern und Rechtspopulisten nicht vielmehr eisern verteidigen? Obgleich zu Lebzeiten bekennender Sozialdemokrat und solidarisch mit der Arbeiterklasse wie mit marginalisierten Gruppen, würde Rorty darauf antworten: Nein, das Klammern an eine singuläre Wahrheit helfe kaum, Konsens herzustellen.
Es entscheidet der Nutzen fürs Gemeinwohl
Denn keine Überzeugung könne für immer geltend gemacht werden: So wissen wir nicht, welche Ereignisse oder wissenschaftliche Neuerungen der Zukunft die Faktenlage verändern. Rorty schlägt stattdessen einen anderen Weg vor, um sich auf wahre Aussagen (im Sinn der Philosophie) und richtiges Handeln (für die Politik) zu einigen.
Stellt jemand eine Behauptung auf, zähle in erster Linie, ob sie gegenüber einer möglichst großen Gruppe zu rechtfertigen ist, und zwar vor einer „kompetenten Hörerschaft“. Das leuchtet ein: Die These, die Erde sei flach, konnte im 17. Jahrhundert der Weltumsegler Magellan widerlegen, heute ist dafür schon ein Viertklässler kompetent genug.
Rortys Hinweis darauf, dass man dabei auch an eine mögliche „künftige Hörerschaft“ denken sollte, zeugt von der Praxisnähe seiner Theorien. Auf aktuelle Probleme bezogen, könnte von pragmatistischer Warte aus einiges dafür sprechen, Gesetze zum Klimaschutz dem unregulierten Wirtschaftswachstum vorzuziehen. Mag eine verpflichtende Reduktion des CO2-Ausstoßes die Industriegewinne drücken, lassen sich Wachstum und Wohlstand einer zunehmend kleinen Gruppe angesichts der hohen Kosten, die andere Gemeinschaften und künftige Generationen dafür zahlen, kaum mehr rechtfertigen.
Die anderen überzeugen
Demokratie, die ja niemals im abstrakten Raum stattfindet, sondern durch eine Vielzahl von materiellen Zwängen und widersprüchlichen Interessen bedingt ist, lebt nach Rorty vor allem von solchen „Rechtfertigungspraktiken“. Die Gesellschaft muss sich darin üben und ihre Nachkömmlinge dazu erziehen. Bei aller Gelehrtheit ist Rortys Ansatz klar emanzipatorisch und zielt darauf, in den Dialog zu treten. Das Ziel demokratischer Politik müsse sein, nach „mehr Ehrlichkeit, mehr Wohltätigkeit, mehr Geduld, mehr Inklusivität“ zu streben.
Wie aber als liberale Demokratin mit Menschen umgehen, die Angehörigen anderer kultureller Gruppen die Kompetenz oder gar ihre Menschlichkeit absprechen? Mit der Überlegenheit seiner Werte zu argumentieren, bringe den Dialog jedenfalls nicht voran, so Rorty. Ebenso wenig Erfolg verspreche der Versuch, dem Gegenüber die Widersprüchlichkeit seiner Argumentation darzulegen.
Begegne er an einer amerikanischen Universität etwa einem engstirnigen Kuratoriumsmitglied, das Schwarze und Frauen nicht als Gesprächspartner ernst nehme, schreibt Rorty mit Blick auf den schon in den 90ern angefachten Streit um Political Correctness, bliebe nur der Versuch, „den Betreffenden durch gutes Zureden und die üblichen indirekten Mittel zu mehr Toleranz zu bewegen, indem ich etwa Bespiele für heutige Selbstverständlichkeiten anführe“ oder „die kulturellen Leistungen der Schwarzen, der lesbischen Atheistinnen, usw.“ Gleichstellung nicht auf ein moralisches Argument zu gründen, kann befremdlich erscheinen. Doch auch die Würde des Menschen ist für Rorty eben ein gesellschaftliches Konstrukt und kein Naturgesetz.
Wo liegen die Grenzen der Solidarität?
Wie schwierig es unterdessen bleibt, die Welt in eine gerechtere zu verwandeln, vergisst auch Rorty trotz des hoffnungsvollen Appells an Demokrat:innen seiner Zeit, der im Buch immer wieder anklingt, nicht.
Die Welt begreift er - ähnlich wie Bruno Latour, Gilles Deleuze und Donna Haraway - als ein sich stets veränderndes Beziehungsgeflecht, in dem handfeste Dinge wie Kommunikation gleichermaßen Anteil haben: „sprachliche Beschreibungen der Welt sind auch ihrerseits nichts weiter als solche Beziehungen“. Jenseits davon gebe es nichts: „Alle Metaphern der Vertikalität müssen vermieden werden.“
Es bleibt dennoch die Frage: Was liefert angesichts des Beziehungswirrwarrs noch Orientierung? Das Dilemma, es nicht allen recht machen zu können, verschärft sich, wie Rorty zeigt, am Beispiel der Globalisierung, die zum Ende des 20. Jahrhunderts Fahrt aufnahm. Stimme die Annahme, schreibt er dazu, dass Demokratie und Liberalismus „von wirtschaftlichem Wohlstand getragen werden“, dürften diese „keine radikale Globalisierung des Arbeitsmarkts überleben“.
Eine Vorhersage, die sich gut zwanzig Jahre später angesichts des rasanten Aufstiegs von Rechtspopulisten rund um die Welt als treffend herausgestellt hat. Ebenso lasse sich das Gedankenspiel der Familien im Atombunker auf die Gemeinschaften des globalen Nordens und Südens übertragen. Mit zunehmend knappen Ressourcen befänden wir uns global in einem ähnlichen Dilemma: Sollen die liberalen Demokratien auf Kosten der ärmeren Mehrheit der globalen Bevölkerung ihren Wohlstand und ihre Freiheiten aufrecht erhalten oder sie „um der egalitären ökonomischen Gerechtigkeit willen aufopfern“?
Die Frage, auf die Rorty keine Antwort geben konnte, ist zum einen seither immer drängender geworden. Zum anderen liefern einen Teil der Antwort auch die veränderten Umstände: die sich verschärfende Klimakrise und seit einer Weile der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Sie beide rütteln am Wohlstand der Industrieländer und den vermeintlichen Gewissheiten des sogenannten Westens.
Was könnte man als Pragmatistin des 21. Jahrhunderts dazu sagen? Vielleicht: Wenn die multiplen Krisen die liberalen Demokratien dazu bringen, über globale Gerechtigkeit nachzudenken und mehr Menschen in die Loyalitätsgemeinschaft einzubeziehen - dann ist das zwar kein erhabener Beweggrund. Aber es reicht als Rechtfertigung, einen neuen Weg einzuschlagen.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false