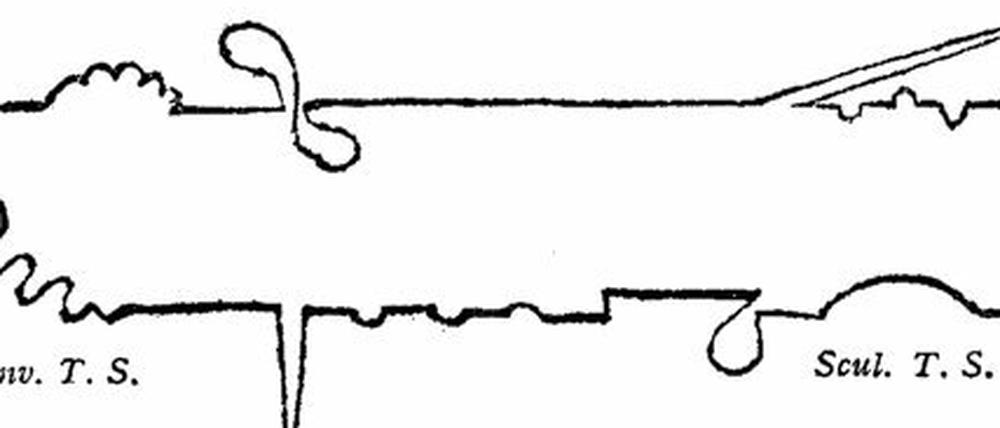
© Wikimedia
Ideen für das neue Jahrtausend: Grün ist alle Theorie und grau des Lebens Baum
Was kommt nach dem Poststrukturalismus? Ein junges Kollektiv sammelt Belege für eine neue Literaturtheorie nach 2001.
Was kann ein Kompendium zur „Literaturtheorie nach 2001“ taugen, das auf 134 Seiten nur zwei lebende Schriftsteller erwähnt, nämlich Daniel Kehlmann und, in einer Bibliografie versteckt, Christian Kracht? Mit W. G. Sebald taucht in der Einleitung jemand auf, der nur dazu dient, mit seinem Todesjahr 2001, das wiederum an das Geburtsjahr von Billie Eilish gekoppelt wird, den Beobachtungszeitraum abzustecken.
Dann muss man schon ins Jahr 1920 zurückgehen, um auf Hugo Ball als Verfasser des Lautgedichts „Karawane“ zu stoßen, oder gleich ins Jahr 1903, um eine Anspielung auf Henry James’ Roman „Die Gesandten“ zu finden. Der arme Goethe gibt lediglich mit „Wanderers Nachtlied“ ein Gastspiel – und als Erfinder des Begriffs Weltliteratur. Damit hat es sich mit den Primärtexten.
Ein vernichtendes Urteil scheint unvermeidlich, zumal Literaturtheorie nicht einfach mit wechselnden Methoden einen unveränderlichen Gegenstand bearbeitet, sondern die sich wandelnden Gegenstände zugleich passende Werkzeuge hervorbringen. Wenn es nicht die zeitgenössische Literatur ist, die sie zu zeitgenössischen Erkenntnissen zwingt, was ist es dann?
[Für alle, die Berlin schöner und solidarischer machen, gibt es den Tagesspiegel-Newsletter „Ehrensache“. Er erscheint immer am zweiten Mittwoch im Monat. Hier kostenlos anmelden: ehrensache.tagesspiegel.de.]
Man entkommt diesem Problem nur, indem man erklärt, dass Literaturtheorie mit Literatur im strengen Sinn nur bedingt zu tun hat. Sie ist keine reine Wissenschaft von der Literatur, sondern eher eine Wissenspoetik, die sich jedem Bereich zuwenden kann. Sie begreift die Welt als Text, und sie liest alle Texte der Welt, gerade da, wo diese nichtliterarisch sind. Sie schlägt Schneisen durch die Zeiten und Räume, und sie nimmt sich Klischees, Projektionen und Trugbilder vor.
Die Mutter aller Theorie
Die Literaturtheorie ist so verstanden die Mutter aller Theorie: ein transdisziplinäres Unternehmen, deren empirisch mal mehr, mal weniger fundierte Einsichten dazu beitragen, sich und die eigene Kultur besser zu verstehen. Die Klassiker dieser Art von Literaturtheorie, Michail Bachtin mit seinen Untersuchungen zur Lachkultur, Gaston Bachelard mit seiner Poetik des Raumes oder Edward Said mit seiner Kritik des westlichen Orientalismus, ließen sich nie einzelnen Fächern zuordnen.
Der Kreis junger Literaturwissenschaftler, der hier in 14, von wechselnden Kleinkollektiven verfassten Miniaturessays die aktuellen Debattenfelder sondiert, stellt sich dabei insofern ein Bein, als es heißt, dass diese Theorie, dich sich in ihrer Universalität selbst schon den Totenschein ausgestellt hatte, nun zu einer sehr viel bescheideneren Form von Literaturtheorie zurückkehre.
Andererseits öffnen Stichworte wie Kognition, Körper, Materialität oder Umwelt den Blick weit über die geisteswissenschaftlichen Landesgrenzen hinaus in die Naturwissenschaften. Vor 20 Jahren wäre das so nicht geschehen. Denn die leitende Frage lautet: „Was kommt nach dem Poststrukturalismus?“ Wer also beerbt mit welchen Ideen das Denken von Roland Barthes, Michel Foucault und Jacques Derrida, das an den Universitäten noch immer fest verankert ist?
Das vorliegende Büchlein ist so etwas wie der Anbau zu einer bis auf einen einführenden Aufsatz unkommentierten Leseliste, die vor drei Jahren unter dem Titel „Theorie – 100 Bücher nach 2001“ (Works and Nights) schon einmal einen neuen Kanon zu definieren versuchte.
Zusammenschau weit auseinanderliegender Gebiete
In seinem fragmentarischen, voraussetzungs- und verweisungsreichen Charakter ist es weit entfernt von einem soliden Haus, aber in der Zusammenschau derzeit die einzige Möglichkeit, einen Überblick über teils weit auseinanderliegende Forschungsgebiete zu gewinnen.
Die fußnotenfreien Texte, denen jeweils eine knappe Bibliografie zum Weiterlesen folgt, sind von unterschiedlicher Dichte und Brauchbarkeit. Ihr größtes Manko ist, dass sie durch den Verzicht auf Anschauungsmaterial oft nur eine unzureichende Vorstellung von der Tragweite ihres Gegenstands vermitteln.
Die Frage, unter welchen Bedingungen heute Kulturtransfer stattfindet, welche hybriden Formen er zeugt und wie er zu Auseinandersetzungen über legitime und illegitime Aneignung führt, erschließt sich aus dem Essay „Grenze“ allein nicht. Und die literarischen Endzeitimaginationen, die sich an die intellektuelle Konjunktur des Anthropozäns knüpfen, eines neu eingeführten Erdzeitalters, das im ökologischen Alltag unter Klimawandel firmiert, deutet „Umwelt“ nicht einmal an.
Auch wird die mehrfach genannte Trias von Race, Class und Gender nur als wertvoller begrifflicher Anstoß von Diskursverschiebungen ins Spiel gebracht, nicht aber als Triggerset einer unfruchtbaren moralischen Empörung, die Texten keinen ästhetischen Eigensinn zubilligen will.
Kontinuität inmitten der Brüche
„Literaturtheorie nach 2001“ macht deutlich, dass um die Jahrtausendwende herum tatsächlich eine neue Epoche angebrochen ist. Wünschenswert für künftige Darstellungen wäre allerdings, eher Kontinuitäten als Brüche zu entdecken. Der vielzitierte „Tod des Autors“, den Roland Barthes einmal verkündete, hat sich nicht weniger erledigt als das gerne missverstandene „Verschwinden des Menschen“, das Michel Foucault in der „Ordnung der Dinge“ ankündigte.
Was damit gemeint war, nämlich die Entrückung des Einzelnen aus seiner selbstherrlichen Individualität, hinein in abstraktere Zusammenhänge, betrifft uns heute mehr denn je. Schon der Begriff des Anthropozäns lebt von der Dialektik, dass der Mensch einerseits der bestimmende Faktor allen irdischen Geschehens ist, sich in den unüberschaubaren Wechselwirkungen für das, was man einmal Natur nannte, aber längst das Heft des Handelns aus der Hand genommen hat. Er misst sich mit den Gewalten, die er selbst entfesselt hat.
Auch die digitale Erschließung von Textmeeren ganzer Zeitalter – statistische Methoden, die Franco Moretti unter dem Stichwort „Distant Reading“ an der Stanford University als Gegenentwurf zum hermeneutischen „Close Reading“ entwickelte – verstößt den Menschen von seinem Thron: „Distant Readding“ betrachtet den Menschen als in die Vokabulare seiner Zeit eingeschlossenes Produkt und Ameise innerhalb eines Baus, dessen ganze Dimension er selbst nicht durchschaut.
Es ist nur allzu verständlich, wenn parallel eine geradezu trotzige Eventisierung von Literatur einsetzt, die das Autoren-Ich noch einmal mit der Gloriole des einsam aus sich heraus schaffenden Künstlers versieht.
Patrick Durdel, Florian Gödel u.a. (Hg.): Literaturtheorie nach 2001.Matthes & Seitz, Berlin 2020. 134 Seiten, 12 €.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false