
© avant
Comic-Übersetzung: Wie Dinge nicht sind
Die Kanadierin gg debütiert in Deutschland mit „Wie Dinge sind“ und zeigt exemplarisch, wie wenig Einfluss Künstler*innen auf übersetzte Titel haben.
Philipp Bovermann merkte in der Süddeutschen Zeitung vom 14.11.2020 anlässlich seiner Rezension von Moa Romanovas „Identikid“ aus dem avant-Verlag an, dass der deutsche Titel „eine sagenhaft doofe Übersetzung des Originaltitels 'Paniikkiprinsessa'“ sei. Was für mich die Frage aufwarf, warum bei besagtem Verlagshaus aus dem im Original bei Koyama Press erschienenen „I'm not here“ der Künstlerin gg schließlich „Wie Dinge sind“ (avant, 104 S., 14 €) wurde.
Allerdings – was Bovermann da schreibt, ist nur bedingt korrekt, wie ich auf Twitter lernen durfte. Trotzdem wäre 'Panikprinzessin' als zur Benennung der Geschichte um eine von Angststörungen geplagte junge Frau angemessener, wenngleich das der Titel der finnischen Übersetzung ist.
Der schwedische Originaltitel lautet hingegen „Alltid fucka upp“ (Always fuck up) und spielt auf „Aldrig fucka upp“ (Never fuck up) an, ein Krimi aus der Stockholm-Noir-Reihe von Jens Lapidus. In den USA erschien Romanovas Comic übrigens als „Goblin Girl“ bei Fantagraphics, die es als unter anderem Verantwortliche für das mit Sekundärliteratur befasste „Comics Journal“ eigentlich feinfühliger hätten handhaben können und – nun ja. (Offenlegung: Ich bin als Autor für das „Comics Journal“ tätig.)
[Die Angst vor der Angst: Wie die Schwedin Moa Romanova in ihrem Comic „Identikid“ vom Leben mit Panikattacken erzählt.]
Beide Betitelungen, also die englischsprachige für „Wie Dinge sind“ und die Schwedische für „Identikid“, hätten im Deutschen nicht nur außerordentlich gut funktioniert, sondern die jeweiligen Inhalte der Comics prägnant vermitteln können.
Stattdessen wurde sich für austauschbare und mit allem möglichen Assoziationen aufladbare Allerweltstitel entschieden, und ich musste an Carter Scholz' Erzählung „The Nine Billion Names of God“ denken, in welcher der in Comicgefilden zuweilen recht firm agierende Science-Fiction-Autor versucht, eine unter demselben Titel bereits von Arthur C. Clarke verfasste und Wort für Wort exakt genauso belassene Kurzgeschichte an ein Magazin zu verkaufen.
Begründung: Er hätte zwar genau dieselben Worte wie Clarke verwandt, doch bei ihm hätten sie eine gänzlich andere Bedeutung. Das ist natürlich sehr fortgeschrittene und subtile Literaturkritik, und vielleicht unterschätze ich Verlagshäuser einfach nur arg.
Buchmachermentalität, oder: Lost in Translation
Ach ja, Kritik, deswegen sind Sie ja wahrscheinlich hier, und nicht wegen Spitzfindigkeiten bezüglich der Übersetzung – aber, ENTSCHULDIGUNG, das spielt schon eine Rolle. Denn in dem von avant-Verlagsinhaber Johann Ulrich aus dem Englischen ins Deutsche übertragenen Comic heißt es unter einem Panel aus ggs Geschichte um eine ihren Platz in der Welt und Halt im Leben suchende junge Frau, die gerade ihrer Mutter ein Pflaster aufklebt – die Autorin nutzt keine Sprechblasen zur Vermittlung der Erzählung, sondern lediglich Bildunterschriften: „Das hilft überhaupt nichts“.

© avant
Im Original steht dagegen „This isn't really fixing anything“. Somit geht diesem unterstreichenden Moment die mit der ätherischen Visualisierung von Flüchtigkeit einhergehende Subtilität sowie die Quintessenz der Kunstform, nämlich die Verschmelzung von Bild und Wort zu einem erst weiter- und dann zusammengedachten Inhalt verloren, denn die Tochter fotografiert leidenschaftlich – was ihre Art ist, vergängliche und fliehende Dinge festzuhalten, eben fixing it on film. Dazu passt auch die Seitenarchitektur, die sich in Widescreens und Dekompression ergeht, alles klar mit Foto und Film assoziierbar, klick klick.
Vielleicht aber wurde der eigentliche Inhalt des Comics, nämlich die Suche nach einem sinnstiftenden Platz in der Welt auch der angestrebten Vermarktung zuliebe geopfert. Beworben wird der Titel nämlich zusammen mit Davide Reviatis „Dreimal spucken“ unter der Überschrift „Graphic Novels über Antiziganismus, Rassismus und Migrationserfahrungen aus Italien und Kanada“.
[Der tägliche Tagesspiegel-Newsletter „Checkpoint“ mit Naomi Fearns Polit-Comic „Berliner Schnuppen“ - hier geht's zur Anmeldung.]
Bestenfalls die Migrationserfahrung der Mutter, deren Wundschnellverband asiatisch aussehende Schriftzeichen aufweist, mag für dieses vermutlich als brandaktuell empfundene Verschlagwortungsmarketing und einige dieser Sichtweise folgenden „Rezis“ als Begründung herhalten, aber das ist nur ein geringer Teil dessen, was hier tatsächlich vermittelt wird: eine international lesbare Einsamkeit und die über Grenzen hinweg einladende Identifikationsfigur einer jungen Frau, die kontinuierlich nah am Abgrund oder auch schon mal auf Fensterbänken in den Wohnungen anderer Leute wandelt, nicht ganz unähnlich der Protagonistin in „Shit Is Real“ von Aisha Franz.
Daher bewirkt die inhaltliche Reduktion des Comics auf den ehemaligen Einwanderungsstatus der Mutter vermutlich eher das Gegenteil von einer eventuell nur gutgemeinten Aufmerksamkeit gegenüber Belangen von Personen mit wie auch immer geartetem Migrationshintergründen.
Dass das auch alles ein leicht unüberlegter Schnellschuss gewesen sein mag, lässt der Klappentext vermuten, der merkwürdig abgebrochen wirkt und sich so liest: „Die Geschichte einer jungen Frau der zweiten Generation, die trotz der auf ihr lastenden Erwartungen versucht, ihren eigenen Weg zu finden.“
Hätte avant doch einfach „der zweiten Generation“ (von was?) weggelassen, der Inhalt wäre treffend umrissen wie ggs Artwork zwischen scherenschnittartiger Kunst im Stil von Zeichentrickfilmpionierin Lotte Reiniger und Spaniens Comiclyrikerin mit Zeichenstift, Emma Rios, oder der Meisterin der Leerstellen zur Interpretation, Aidan Koch.
Bild Dir Deine Meinung
Abweichend von der Originalausgabe aus Kanada durch Koyama Press fällt der Umfang des Comics im Deutschen auf Grund der Verwendung von dickerem Papier weit voluminöser aus. Ich werde mich allerdings hüten zu mutmaßen, ob diese Entscheidung der Überlegung zu Grunde lag, dem Erscheinungsbild eines *guten* Buches im Buchhandel gerechter zu werden.
Auf dem Cover der deutschen Ausgabe ist eine interpretierbare Zwei-Personen-Darstellung einer jungen Frau zu erspähen, deren entstofflichtere Variante eine andere Frisur und einen abweichend lesbaren Dresscode aufweist: Schlauch-Minikleid und Boots, während das schattenwerfende Gegenstück im Leisure Look daherkommt – betont freizeitig und locker plus Sneakers – was zwar den inneren Konflikt der Hautperson visualisiert, aber für ein Titelbild den Inhalt nicht exakt genug für eventuell am Erwerb Interessierte auf den Punkt bringt.

© avant/Koyama Press
Im Original werden zwei upside-down gegeneinander gelegte und nur durch die Frisuren lesbare Kopfhälften gezeigt, denen Details wie Nase, Mund und Augen zwar fehlen, aber durch am Comiclesen geübte Prozesse mit den Buchstaben des Titels, die sich über die gespaltene Darstellung des Gesichts verteilen, induktiv ausgefüllt werden können.
Hier wird das halbdurchlässige Wesen der jungen Frau in einer Art stilisierter Überbelichtung wesentlich treffsicherer abgebildet, dabei insbesondere die obsessive Hingabe an die Fotografie und das Medium unterstreichend, welches diese Informationen vermitteln wird.
[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Derartige und wiederkehrenden Stilmittel ggs sind, wie ihre Themen, stets mit der Angst davor verknüpft, nicht bemerkt zu werden. Dank immer mehr medialer Möglichkeiten der Selbstdarstellung wird sozialer Stress generiert – gegen das Verblassen inmitten einer Welt, in der die eigene Inszenierung eben nicht nur kreativer Ausdruck sein kann, sondern auch Selbstausbeutung ohne jegliche Berücksichtigung eigener Befindlichkeiten.
Oder, um es mit der Neurowissenschaft auszudrücken: Ein durch Nichtwahrnehmung initiierter neurobiologischer Ausnahmezustand bewirkt entweder Aggression oder Depression, Letztere einhergehend mit Rückzug – was das unter der schönen Oberfläche brodelnde Worst-Case-Szenario und das werkübergreifende Thema ggs darstellt.
Bereits in ggs bei kuš!-Comics verlegtem „Valley“ zeichnete sich das ab, dort ging es allerdings noch eine Spur unheimlicher zu. Auf mich wirkte „Valley“, da auch kürzer, etwas zielgerichteter und effizienter in der Darstellung zuverlässig zerbrechlicher doch steter Schönheit. „Valley“ ist übrigens wie „I'm Not Here“ im Original 2017 erschienen, einem der kreativsten Jahrgänge im Schaffen des zeitgenössischen Comic, erwähnt seien hier nur Anna Haifischs „Drifter“ und Blaise Larmees „2001“.
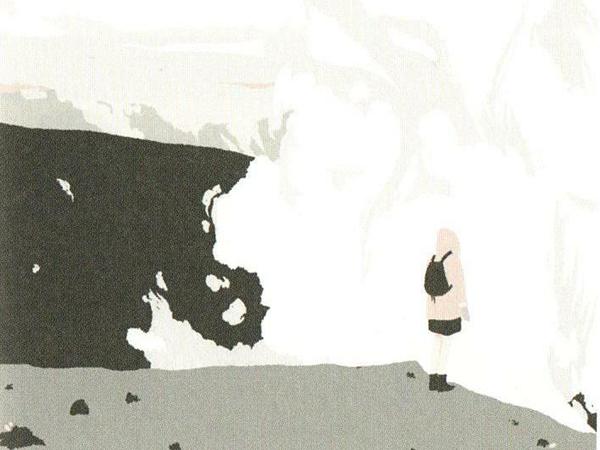
© Koyama Press
Trotz einiger Schönheitsfehler ist es gut, dass avant einen der besten wenngleich nischigen Titel à la „Wie Dinge sind“ im Deutschen zugänglich macht, das kann der Horizonterweiterung im Land nicht schaden. Wie bitter nötig das ist, kann in dieser arg uninformierten Moderation verfolgt werden, welche die Folgen jahrelanger Graphic-Novel-Propaganda zu Ungunsten des Comic ab Minute 9:30 ansichtig macht.
Der englischsprachige Titel von „I'm Not Here“ weist ebenfalls auf das Ende hin, dessen letzte Panelbildunterschrift mit „Ich bin nicht zu Hause“ ins Deutsche übersetzt wurde – was durchaus ein besserer, weil Fragen aufwerfender Titel gewesen wäre – und überdies auf das bereits angesprochene Wandeln in fremden Wohnungen verwiesen hätte. Und *Trommelwirbel* doch noch das in Spurenelementen vorhandene Thema der Immigration transportiert hätte.
Aber vielleicht dann bald in einer allen Beteiligten zu wünschenden Zweitauflage, was bestimmt auch die das Original herausgebende Annie Koyama, Kanadierin mit asiatischen Wurzeln und viele Jahre - sie hat Ende 2020 offiziell ihre Verlagstätigkeit beendet - eine/r der sich am meisten für Nachwuchskünstler*innen engagierenden Verleger*innen im nordamerikanischen Raum überhaupt, freuen dürfte.
Und wenn Sie jetzt fragen, wieso ich das in geschlechtergerechter Formulierung inkl. *innen schreibe, wo Koyama doch eh eine Frau ist, dann nur, weil ich anderen Geschlechtern ersparen möchte, sich einfach nur mitgemeint zu fühlen – und es zudem nur wenig MÄNNER oder andere Verleger*innen überhaupt gibt, die Annie Koyama Paroli bieten könnten - Entdeckerin von einflussreichen Künstler*innen wie Jesse Jacobs, Michael DeForge und Mickey Zacchilli. Aber das wäre glatt einen eigenen Artikel wert.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false