
© Chen Jing/Xinhua/imago images
Forschung zum Coronavirus: Was bei den besorgniserregenden Daten auch Hoffnung macht
Wofür Forscher bei Sars Monate brauchten, gelang beim Wuhan-Virus in wenigen Tagen. Das stimmt – trotz schlechter Nachrichten – zuversichtlich. Ein Kommentar.

Virologen warnen seit Jahren vor Zoonosen, Krankheiten also, die von Tieren auf Menschen übergehen. Tatsächlich werden jährlich neue solche Erreger beim Menschen nachgewiesen. Das Coronavirus aus Wuhan ist eine solche Zoonose.
Durch Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergehen, hat in den letzten Jahren einige wenige Epidemien gegeben. Die Schweinegrippe-Pandemie im Jahr 2009 war eine davon, fiel aber weit milder aus, als seinerzeit befürchtet.
Wie es mit dem Coronavirus aus der chinesischen Metropole Wuhan weitergeht, weiß derzeit niemand zu sagen. Die abwiegelnden und beruhigenden Stimmen jedoch verstummen zusehends, eine globale Pandemie mit vielen Opfern wird nicht mehr ausgeschlossen. Und der Keim könnte sich über Jahre und Jahrzehnte zu den allgegenwärtigen infektiösen Gesundheitsbedrohungen gesellen, so wie Grippe, Aids und alle möglichen so genannten Kinderkrankheiten.
Die Aussichten haben sich auch aus Wissenschaftler-Sicht also eher verdüstert. Vergessen darf man dabei aber eines nicht: In den vergangenen Jahren haben sich die von eben jenen Wissenschaftlern entwickelten Methoden zum Umgang mit solchen Ereignissen massiv verbessert, ja Quantensprünge gemacht.
Coronavirus aus Wuhan: Bei Sars waren die Forscher nicht so schnell
Hätte etwa das Sars-Virus 2002/2003 die Eigenschaften gehabt, die jetzt dem Wuhan-Erreger zugeschrieben werden – von womöglich hoher Infektiosität schon bei symptomfreien Personen und möglicherweise auch hoher Sterblichkeit bis hin zu einer wohl relativ gefährlichen Mutations-Neigung – dann hätte es vermutlich eine globale Pandemie ungekannten Ausmaßes gegen, noch bevor Forscher überhaupt im molekularen Detail gewusst hätten, womit sie es zu tun haben.
Am Sonntag wurde vom ersten Verdachtsfall in Deutschland berichtet, in Berlin, vor unser aller Haustür. Schon Stunden später gab es Entwarnung. Christian Drosten an der Charité hatte Proben des Patienten genetisch untersucht und das Virus nicht gefunden. Wie selbstverständlich wurde das dann vermeldet und zur Tagesordnung übergegangen. Das dies überhaupt möglich ist, ist aber im Grunde ungeheuerlich, im positiven Sinne.

© dpa
Drosten ist der Mann, der 2003 das Sars-Virus anhand genetischer Analysen identifizierte. Auch die komplette Gensequenz konnte er in einer Mega-Anstrengung zusammen mit Kollegen vorlegen – aber erst zwei Monate, nachdem der Ausbruch seinen Höhepunkt überschritten hatte.
Wuhan-Virus wurde in kürzester Zeit entschlüsselt
Für das Wuhan-Virus haben er und seine Arbeitsgruppe in kürzester Zeit nicht nur die Gensequenz bestimmt, sondern auch einen Schnelltest entwickelt, der an einem Sonntagnachmittag innerhalb von wenigen Stunden Sicherheit bringen kann.
Forscher in China und weltweit sind derzeit in der Lage, Viren von immer neuen Patienten ebenfalls molekular zu untersuchen und aufgrund der genetischen Veränderungen zu bestimmen, von welchen Virenvarianten sie abstammen, wie schnell sie mutieren, und in begrenztem Maße auch Voraussagen zu machen, wie der Keim sich in Zukunft verhalten könnte.
Coronavirus: Ohne die Forschungsfortschritte wären wir noch heute im Blindflug
Vieles von dem, was jetzt alarmierend klingt und Experten ihre zunächst eher optimistische Einstellung bezüglich der Verbreitung des Virus überdenken lässt, wäre ohne diese neuen, schnellen, verlässlichen, erschwinglichen molekulargenetischen Methoden überhaupt nicht denkbar. Ohne sie befänden wir uns bezüglich des Keims namens 2019-nCoV derzeit noch weitgehend im Blindflug.
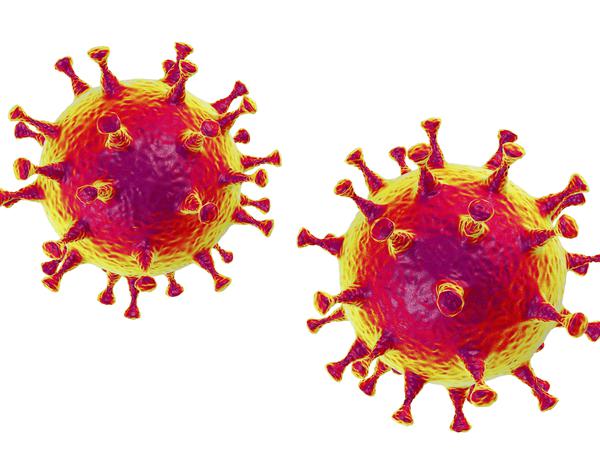
© Imago/Science Photo Library
Und zu den Möglichkeiten, das Virus nachzuweisen und aus Details wichtige Schlüsse zu ziehen, kommt noch etwas weiteres hinzu: Die Optionen, gezielt Medikamente zu entwickeln oder auch relativ schnell Impfstoffe bereitzustellen, haben sich seit Sars massiv verbessert.
Coronavirus aus Wuhan: Schon jetzt läuft die Suche nach Medikamenten
Und es wird jetzt, in dieser Sekunde, genau daran gearbeitet, Mittel gegen das neue Coronavirus zu finden. Das ist möglich, weil man beispielsweise schon jetzt weiß, welche Moleküle das Virus braucht, um in menschliche Lungenzellen einzudringen.
[Verfolgen Sie die Nachrichten zum Coronavirus aus Wuhan in unserem Liveblog.]
Entscheidend ist mit ziemlicher Sicherheit ein Enzym namens ACE2. Man kann also etwa Substanzen testen, die dieses Molekül blockieren. So könnte dem Virus der Zutritt in menschliche Zellen verweigert werden. Wenn alles gut geht, könnte das zu einem Medikament gegen das Coronavirus werden.
Silberstreif am Horizont
Dazu kommt, dass Forscher international schlicht aufgrund verbesserter Kommunikation- und Speicher-Möglichkeiten heute um ein vielfaches besser kooperieren, sich abstimmen und Informationen austauschen können.
Die Nachrichten über die Epidemie mögen derzeit also beunruhigend sein, auch die aus den Forschungslaboren. Aber allein, dass diese Labore überhaupt in der Lage sind, diese Nachrichten so schnell zu produzieren und bereitzustellen – und dann ebenso schnell weiter an möglichen Strategien und Lösungen arbeiten können, ist mehr als ein Silberstreif am Horizont.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false