
© Doris Spiekermann-Klaas
Tresor-Gründer Dimitri Hegemann: „Wer nur aufs Geld guckt, macht Fehler“
Dimitri Hegemann wäre gern Professor für Subkultur und tanzt nie zu Techno. Einst war der Club-Chef stolz auf den West-Berliner Ausweis und fand die Mauer gut.
Herr Hegemann, wir befinden uns im Keller eines alten Kraftwerks in Mitte. Die Decke ist niedrig, die Wände aus Beton, überall stehen verrostete Schließfächer. Um hier zu feiern, kommen jeden Samstagabend hunderte Leute aus aller Welt her.
Das ist gut so, aber Berlin wird manchmal missverstanden: als Ballermann. Das schafft auch Probleme. Da kommen Gruppen, die extra vorglühen. Zehn Jungs, voll auf Alkohol, die schon in der Schlange Stress machen, die will ich nicht haben.
Ihr Publikum ist zwischen 18 und 30 Jahren. Können Sie mit dem etwas anfangen?
Nein, kann ich natürlich nicht. Ich bin 60. Mir gefällt nach wie vor die Energie der Leute. So ein Techno-Club bringt Welten zusammen. Theatermacher, Philosophen, Elektriker, dieses Zwanglose der Parallelwelt, dieser Schutzraum hinter der Tür lockt die Jungen an.
Schlägt man die „zitty“ auf, stehen dort für Samstag 30 Techno-Partys. Gibt es zu viele Clubs?
Das könnte sein. Aber es würde ganz schnell viel weniger geben, wenn eine Sache passiert, nämlich die Sperrstunde wieder eingeführt wird. Das gäbe einen Dominoeffekt. Easyjet, Hostels, Gastronomie, Clubs. Das Berliner Nachtleben würde zusammenbrechen. Ich glaube, 60 Prozent aller Besucher kommen wegen der alternativen Kultur nach Berlin – und nicht wegen der Shoppingmalls. Die Rolex kannst du auch in Dubai kaufen, aber Clubs wie in unserer Stadt findest du dort nicht.
Der Tresor war einer der ersten Techno-Clubs Berlins.
Als wir 1991 anfingen, hatten wir fast eine Alleinstellung. Es gab drei Clubs, die eine ähnliche Spielstätte hatten, heute blicke ich da nicht mehr durch und kenne die auch nicht alle. Ich gehe selten aus.
Ihr Büro ist über dem Tresor, im ersten Stock des Kraftwerks in der Köpenicker Straße.
Da bin ich nicht mehr jeden Tag. Ich habe ein tolles Team, das den Laden führt.
Was machen Sie?
Ich arbeite an der Berlin-Detroit-Connection, ein Kulturaustausch zwischen beiden Städten. In einem weiteren Projekt würde ich gerne mein Wissen in einer Akademie für subkulturelles Unternehmertum an junge Menschen weitergeben.
Wie soll die aussehen?
Es gibt nach wie vor Menschen wie mich aus der Provinz, die zwischen Aussteiger und Dorftrottel wandeln, die Welt verändern wollen und in ihrer Stadt nicht verstanden werden. Diese Leute möchte ich auffangen. Zehn Studenten pro Jahr, ich erzähle denen, wie ich den Tresor aufgebaut habe, dann laufen sie hinter mir her und machen ihre Erfahrungen. Das wäre toll, hier eine Art Harvard für Subkultur zu etablieren: Wie mache ich aus einer Mülltonne ein Unternehmen?
Erzählen Sie es uns. Was braucht man, um einen Club lange erfolgreich zu machen?
Einen ungewöhnlichen Raum, der bezahlbar sein muss, und einen ewigen Mietvertrag. Ein guter Club reift wie ein guter Wein.
Mehr nicht?
Hätte der Club 1991 nicht diesen Raum am alten Standort gehabt, diese verrostete Stahlkammer unter dem ehemaligen Wertheim-Gebäude am Leipziger Platz, wäre er nicht so populär geworden.
Sie haben das Haus im Herbst 1990 zum ersten Mal betreten, nachdem einer Ihrer Freunde auf der Leipziger Straße im Stau stand und es entdeckte ...
... weil wir einen Club im Osten suchten, der Westen war ausgebucht. Die beiden Freunde haben einen Hausmeister gefunden, der ihnen die Schlüssel gab. Als wir dann durch die Doppeltür hineingingen, sah alles furchtbar aus: ein rechteckiger Grundriss, alles parzelliert mit blöden Zwischentüren und Pappwänden. Plötzlich sahen wir ganz hinten ein Regal, dahinter gab es eine Tür. Wir öffneten sie, eine Treppe führte in eine riesige Unterkellerung, und uns schlug dieser heftige Geruch entgegen, so alte, kalte Luft.
"Wir haben uns mit einem Feuerzeug vorwärtsbewegt"
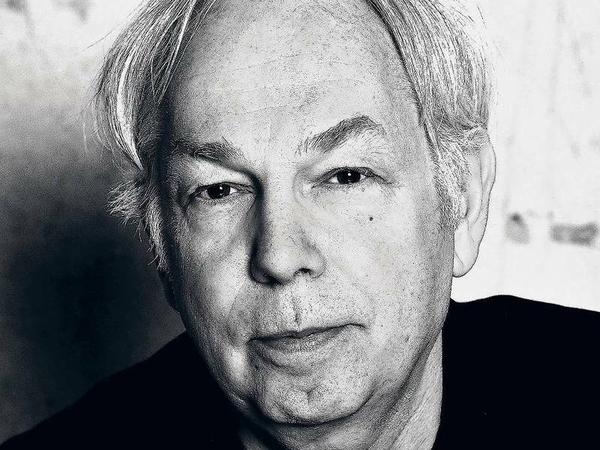
© Doris Spiekermann-Klaas
Hätte der Hitlerbunker sein können.
Die „New York Times“ schrieb später: Hier folterte die Stasi, heute spielen Bürgerkinder Weltkriegs-Musik. Toll erfunden! Als wir das erste Mal hineingingen, wussten wir nicht, was uns erwartete. Wir haben uns mit einem Feuerzeug vorwärtsbewegt. Weiße Kacheln überall. Plötzlich dieser andere Raum, dieses Stahltor, wir sahen die Schließfächer, die Gitter, und waren sprachlos. Es war sofort klar, dieser Ort war etwas Besonderes.
War es schwer, ihn anzumieten?
Nein, wir haben eine Zwischennutzung als Galerie erhalten und dann alles vorbereitet. Wir waren noch in der DDR, also beauftragte ich die Firma Hummel aus Köpenick mit der Renovierung. Sie hat die Kabel geprüft, Wasserleitungen verlegt und immer pünktlich Feierabend gemacht. Selbst am Tag der Eröffnung, am 13. März 1991. Punkt drei waren die weg, und kein Wasser lief.
Eine Katastrophe.
Eine Freundin hat um die Ecke einen Hydranten gefunden, den abgesperrt, einen Schlauch bis zu uns gelegt und dann aufgedreht. Firma Hummel kam am Montag wieder pünktlich angedackelt. So eine Risikobereitschaft wie wir damals brauchen Sie im Clubgeschäft. Menschen, die nur auf das Geld gucken, machen Fehler.
Laut „Bundesanzeiger“ haben Sie 2011 einen Überschuss von 114 000 Euro ausgewiesen und 2013 nur 9000 Euro. Stecken Sie in der Krise?
Wir sind in der Dauerkrise. Dieses Auf und Ab kenne ich seit Jahren. Der Wettbewerb ist schwieriger geworden. In dem besagten Jahr haben wir viel in das Kraftwerk investiert, andererseits sind wir stolz auf 60 angestellte Mitarbeiter. Wir bezahlen fair, aber keiner verdient viel bei uns.
Seit 2008 befindet sich der Tresor am neuen Standort an der Köpenicker Straße. Gehört zu einem Club, dass wie bei Ihnen ein Geldautomat drinsteht?
Mich nervt das, aber die Erfahrung zeigt, wir brauchen den. Der nächste EC-Automat ist am Schlesischen Tor, fast 20 Minuten zu Fuß. Wer da hingeht, kommt nicht wieder.
Wie viel Geld machen Sie pro Wochenende?
Wir haben einen Pro-Kopf-Umsatz um die zehn Euro, am Wochenende kommen 700 zahlende Gäste, 150 stehen noch mal auf der Gästeliste.
Wenn Sie zurückschauen, was ist heute anders in den Clubs als 1990?
Das Bedürfnis zu feiern hat zugenommen. Die wenigsten sind wegen eines bestimmten DJs da, die wollen in einem dunklen Raum zusammenkommen und tanzen. Diese scheinbar endlose Party bleibt die geliebte Verführung. Es wird nicht so viel geredet wie früher im Fischbüro.
In den 1980er Jahren eine Bar im Wrangelkiez ...
... eine Rettungsstation war das! Das Fischbüro war die Wiederentdeckung des Gesprächs.
In West-Berlin unterhielt man sich nicht?
Man stand cool rum, trug Schwarz, war einsam und hatte kaum Geld. Ganz schrecklich. Ich entdeckte das Ladenlokal, weil ich an den Wintermorgen auf dem Weg zur Uni an diesem Fenster vorbeikam. Ein Ofen bollerte, eine Schusterin saß an einer Werkbank und hämmerte auf Schuhen rum. Ich trat ein und fühlte mich geborgen. West-Berlin war ja nicht einfach. Ständig fror ich im Winter, mein Vater schenkte mir regelmäßig zu Weihnachten zwei Zentner Ruhrbriketts. Die hab ich von Nordrhein-Westfalen mit meinem Passat nach Berlin gefahren und dann in den fünften Stock geschleppt.
Den Laden übernahmen Sie, als die Frau auszog?
Ich baute ein Rednerpult hinein, jeder auf dem Podium sollte was erzählen. Käthe B., ein Künstler, der kam rein und sagte: Heute habe ich euch was Besonderes mitgebracht – eine Telefonnummer aus Holland. „Null-Null-Drei-Eins“. Die las er vor, die Gäste brüllten. Nach ihm erzählte eine Frau, wie teuer ihre Klamotten waren. „Dieses Hemd hat drei Mark gekostet.“ Wir waren die Vorläufer für all diese Talkshows im Fernsehen.
Und dieser Laden war der Vorgänger vom Tresor?
Wir sind später in die Köpenicker Straße 6 umgezogen, da entdeckten wir diesen Keller. Die Decke maß nur 1,90 Meter Höhe. Wir haben den ganzen Müll zu einem Haufen zusammengeworfen, Erde drüber, eine Lichterkette drauf und zur Installation deklariert. Wir stellten einen Diaprojektor auf, zwei Lautsprecher, zur selben Zeit kamen diese neuen Klänge auf, House aus Chicago und so.
Haben Sie getanzt?
Nein, ich hab nie getanzt. Das hat mit meiner Tanzschule zu tun. Ich muss mal ausholen. In den 60er Jahren bin ich auf dem Dorf aufgewachsen, Büderich bei Werl, nahe Hamm. Es gab keinen Club, wir haben im Sommer Lagerfeuer gemacht, auf Schützenfesten gefeiert, alles wohldosiert. Geträumt haben wir aber von einem anderen Leben. Der Film „Woodstock“ war eine gewaltige Inspiration, diese Musik, die langen Haare, die Drogen ...
"Da wäre ich sogar fast Walzerkönig geworden"
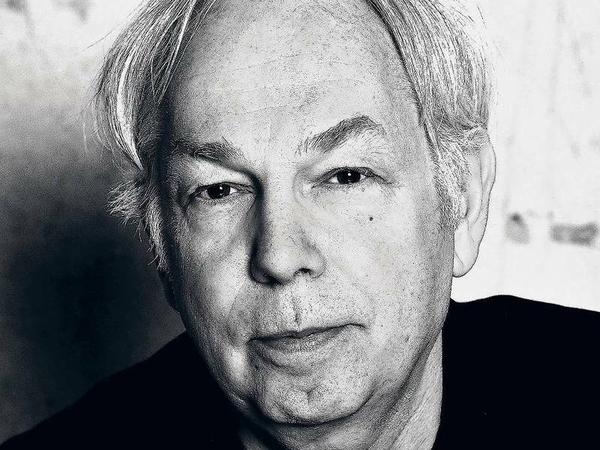
© Doris Spiekermann-Klaas
Wer besaß denn in der Provinz so was?
Es gab ein, zwei Leute, ich nenne sie mal: die Boten. Ein Freund und ich haben uns gelegentlich einen LSD-Trip geteilt, das hat dann vielleicht sechs Mark gekostet. Wir waren neugierig.
Und schön high auf dem Schützenfest.
Nein, auf dem Ball der Tanzschule. Da wäre ich sogar fast Walzerkönig geworden. Aber dann verwies mich der Lehrer des Saales, weil ich mich auf die Knie meiner Tanzpartnerin gesetzt habe. Ging gar nicht, fand er. Seitdem tanze ich nicht mehr.
Klingt nach einer lustigen Jugend.
Nee, mit 18 habe ich aufgehört, Drogen zu nehmen. Der Freund, mit dem ich die Trips einwarf, wurde verrückt. Ist hängen geblieben, ging in Therapie, später wurde er übertrieben gläubig und hat sich erhängt. Zur selben Zeit wollte ich mit Freunden eine Land-WG gründen. Irgendwann fanden wir ein altes Herrenhaus, das vergammelte. Wir standen mit zerrissenen Jeans, langen Haaren und ohne Geld vor dem Besitzer, einem megakatholischen Bauer. Nach drei Minuten hat der uns verjagt. Ich begriff langsam, wir störten. Zum Glück bin ich mit 23 Jahren in West-Berlin gelandet.
Was hat die Stadt Ihnen bedeutet?
Diese Insel war mein Freiraum. Wie meine Träume in der Provinz zerrissen wurden, das tat mir weh. In Berlin war ich erstaunt, was alles geht. Da gab es Galerien, coole Bars mit exzentrischen Gestalten. Ich erinnere mich an eine am Olivaer Platz, die hieß „Belgisch-Kongo“, ein Chinese mit langen Haaren und Zylinder bediente die Gäste. Neu waren für mich Frühstückscafés und Galerien mit Dingen, die ich noch nie gesehen hatte. Und diese angenehme Anonymität. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie stolz ich auf den behelfsmäßigen Berliner Ausweis war. Nicht mehr German, sondern West-Berliner.
Blixa Bargeld sagte mal: „Ohne die Mauer wäre West-Berlin langweilig, wie jede andere Stadt.“
Hat er recht. Heute, 25 Jahre nach dem Mauerfall, schwindet diese Einzigartigkeit. Ich bin damals oft die Mauer entlanggefahren, weil sie ein wesentlicher Ort für mich war. Ein Schutzwall vor Westdeutschland. Sie gab mir Sicherheit und behütete uns Gleichgesinnte.
Das sahen die Ostler anders.
Für mich war Ost-Berlin ein Abenteuer. Um zwei Uhr nachts musste ich draußen sein. Dann ist man halt im Westen weiter ausgegangen.
Sehr pragmatisch.
Bis ich Anfang der 80er Jahre Einreiseverbot bekam. Als ich einmal über den Tränenpalast in den Westen zurückwollte, holte mich ein Uniformierter heraus, und ich wurde stundenlang verhört. Wen haben Sie in Prenzlauer Berg getroffen? Was haben Sie in Plänterwald gemacht? Namen von Musikern fielen. Die Grenzer wussten Sachen, die keiner wissen konnte. Das hat mich beunruhigt. Später habe ich erfahren, dass ich mich in einer Gruppe bewegte, in der Sascha Anderson Rädelsführer war – und er mich vermutlich gemeldet hat.
Ihr Ost-Berliner Kompagnon Johnnie Stieler hat Sie nach der Wende als „lethargisch“ beschrieben ...
... ich bewahre eben die Ruhe ...
... wie kamen Sie mit den aufgedrehten Ravern klar?
Ich habe mir alles angehört, bin halt ein geduldiger Mensch. Ich glaube, weder ich noch die anderen wussten, worum es ging. Das war der Geist des Tresors damals. Ich hatte den Eindruck, alle Gäste waren irgendwann mal Mitarbeiter.
Vor ein paar Jahren haben Sie moniert: „Es ist schade, dass die Markthalle in der Pücklerstraße durch die Billigketten ihre Seele verloren hat.“ Nun lockt die Markthalle Neun die Massen an.
Ich finde es gut, dass die Veränderung eingetreten ist, aber ich finde keinen Platz mehr. Das fühlt sich so an, als würde man ein Essen für zehn Leute machen, und es kommen 85. Das schreckt Menschen meines Semesters ab. Trotzdem, die Betreiber machen einen guten Job.
Fühlen Sie sich in Kreuzberg 2015 zu Hause?
Ich lebe in der Köpenicker Straße, am liebsten würde ich in die Wrangelstraße ziehen, diesen Teil zwischen Skalitzer und Cuvrystraße. Den finde ich so authentisch. Ich habe keine Existenzsicherung, in der Gegend machen sich die kleinen Leute scheinbar alle keinen großen Kopf darum, da fühle ich mich unter Gleichen. Ich gehe auch manchmal in die Kirche, St. Marien, ich bin ja katholisch erzogen.
Sie sind im Alter zum Kirchgänger geworden?
Zur Mette am Sonntag bin ich hin und wieder da. Anschließend gibt es Frühstück, Kaffee, ich setze mich zu den alten Berlinern, die erzählen, wie es vor dem Krieg in der Gegend war. Ich redete viel mit dem früheren Pfarrer, der ein bisschen verzweifelt war, weil die Leute nicht wie in die Markthalle Neun strömen. Kirche ist für mich eine Kindheitserinnerung, obwohl ich ausgetreten bin. Als ich aus Werl wegzog, ging mir das auf den Wecker – und jetzt sehne ich mich nach Spiritualität.
Peter Fox ist aus Kreuzberg weggezogen ...
… der braucht Ruhe, oder?
Hat er SO 36 verraten?
Nein, er hat Kreuzberg geholfen, jetzt kann das Viertel auch ohne ihn. Mich fasziniert es immer noch. Auch wenn mich nachts in der Bahn manchmal die Angst einholt. Mich stört es, dass die Leute alle mit Getränken herumlaufen.
Das berühmte Berliner Wegbier.
Würde ich verbieten. Ginge es nach mir, dürften Tankstellen ab 22 Uhr keinen Alkohol verkaufen.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false