
© imago images/Westend61
Zwischen Sehnsucht und Angst: Was Internet-Pseudonyme über den Zeitgeist verraten
Im Computerzeitalter offenbaren und verstecken Pseudonyme die Identität ihrer Nutzer. Ihr Ursprung aber reicht viel weiter. Eine kleine Kulturgeschichte.
Sein Name war „Fatal1ty“, englisch für Todesfall. Wer sich kurz nach der Jahrtausendwende auch nur ein bisschen in der Computerszene auskannte, kam an dem jungen Mann mit den blonden Locken nicht vorbei. Mit Egoshootern avancierte er zum erfolgreichsten professionellen Videospieler der USA. Eigentlich heißt er Johnathan Wendel und stammt aus Missouri. Aber welche Bedeutung hat schon eine Offline-Identität, wenn man der „tödlichste Typ im Internet“ ist, wie er seinen Ruf später beschreibt. Kaum 18 Jahre alt, zieht Wendel von Turniersieg zu Turniersieg. Und mit ihm sein Alias „Fatal1ty“.
Der tödlichste Typ im Internet
In früheren Zeiten war das Pseudonym vor allem ein Merkmal von Künstlern, politischen Widerständlern und Kriminellen auf der Flucht. Die Tarnidentitäten sollten Schutz bieten, wenn es zu gefährlich war, unter bürgerlichem Namen aufzutreten. Mit dem Computerzeitalter sind die erfundenen Identitäten inzwischen allgegenwärtig geworden. Was offenbaren die Namen, die wir uns in der virtuellen Welt geben?
Zunächst dienen sie der Selbstdarstellung. „GuppyGöttin“ tauscht sich in Fischforen über Wasserwerte aus, „Leseratte 97“ will alle Welt wissen lassen, wie intellektuell sie ist. Pseudonyme erlauben aber auch Tabubrüche, das Bekenntnis heimlicher, schambehafteter oder verbotener Sehnsüchte. So bettelt „StutenZähmer65“ in Onlinechats Frauen um einen One-Night-Stand an, und der republikanische US-Politiker und ehemalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney gestand kürzlich, dass er sich unter dem Twitternamen „Pierre Delecto“ gegen seinen Parteikollegen Donald Trump positioniert. Anscheinend mit Vergnügen: „Delecto“ bedeutet auf Latein „ich bereite Freude“.
Romney bereitet Freude
In Pseudonymen verraten Menschen ihre Überzeugungen, Unsicherheiten, den Wunsch nach Anerkennung und einem Platz in der Welt. Sie verstecken sich dahinter und offenbaren zugleich ein Stück von ihrem wahren Ich. Ein finnischer Programmierer wertete 2018 acht Millionen Onlineprofile auf „Steam“ aus, der weltweit größten Internetplattform für Videospiele. Beliebt waren demnach Pseudonyme wie „Ghost“, „Shadow“ und „Zero“.
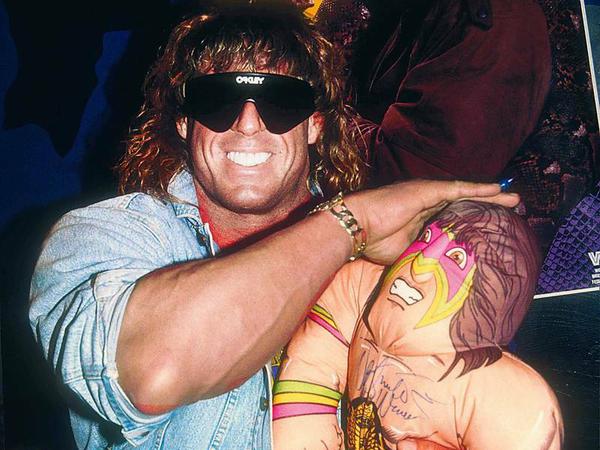
© imago/MediaPunch
Der emeritierte Professor der Universität Leipzig und Experte für Namenswissenschaften Jürgen Udolph sieht darin Parallelen zu den alten Germanen. Damals gaben Väter ihren Söhnen Namen in Anlehnung an gefürchtete Kreaturen wie den Wolf: „Die Stärke des Tieres sollte so auf den Neugeborenen übergehen, damit dieser die Kämpfe in seinem Leben bestehen kann.“ Man wappnete sich also gegen die eigenen Ängste, indem man sich das Bedrohliche aneignete.
Den „Steam“-Daten zufolge liegt „Wolf“ unter Videospielern auf Rang 18 der beliebtesten Pseudonyme. Ein guter Platz – mit Blick auf Spitzenreiter wie dem mathematisch-kühlen „Zero“ scheinen es mittlerweile jedoch nicht mehr wilde Bestien aus dem Wald zu sein, die unsere Furcht bestimmen. Bei den heutigen Favoriten steht offenbar die Angst vor dem Unbekannten im Vordergrund, vor der Anonymität der digitalen Welt.
Sollten wir eine Klarnamenpflicht in sozialen Medien einführen?
Es gibt auch die Angst vor dem, was sich hinter den Pseudonymen verbirgt. Wie groß sie ist, zeigt sich in den Diskussionen zur Klarnamenpflicht. Häufig dienen Pseudonyme als Tarnung bei Hasskommentaren in den sozialen Medien.
Politiker drängen deshalb darauf, dass Online-Identitäten offengelegt werden sollen. So sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer anlässlich von rechter Hetze gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: „Ich möchte wissen, wer hinter solchen Kommentaren steckt.“ Fällt der Deckname weg, handeln die Netznutzer wieder menschlicher. So der Gedanke.
Andere hingegen befürchten im Gegenteil eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wer unter seiner echten Identität auftritt, riskiert mitunter Repressionen. Ein Arbeitnehmer beispielsweise kann nicht online über Missstände in seiner Firma schreiben, ohne dass er seinen Job aufs Spiel setzt. Im Zweifel wird dann lieber geschwiegen.
Diskretion der Whistleblower
In manchen Pseudonymen zeigt sich auch die Sehnsucht, Teil von etwas Größerem zu sein. In der aktuellen Datenbank der MLG, der populärsten Liga für den professionellen Gamingbereich, finden sich Dutzende Nutzer, die sich als „Fatal1ty“ ausgeben. Sie haben den Namen jenes berühmten Videospielers aus Missouri adoptiert, übernehmen dessen Netzidentität.
Solche Nachahmungen haben eine Tradition, die bis weit vor Erfindung des Computers reicht. Im 6. Jahrhundert v. Chr. bildete sich der Kult der Orphiker in Thrakien heraus. Die Griechen sahen die Region als Barbarenland an, wer hier lebte, galt als künstlerisch unfähig. Es sei denn, man hieß Orpheus: Dem Mythos nach konnte der thrakische Leierspieler mit seiner Musik sogar Steine erweichen.
Orpheus als Vorbild
Die Orphiker stahlen seinen Namen und verschafften dem eigenen Werk so eine Aufmerksamkeit, die es sonst nie bekommen hätte. Unter falscher Identität verbreiteten sie zahlreiche Schriften, die Einblicke in die Entstehung der Welt gaben. Die Kultanhänger verstanden sich als Schüler des Orpheus. Mit jeder Schrift stilisierten sie ihr Vorbild noch mehr zur allwissenden Erlöserfigur – und damit indirekt sich selbst. Mit dem Pseudonym überwanden sie die eigene Nichtigkeit.

© picture alliance / dpa
Der „Fatal1ty“-Gamer Jonathan Wendel hat seine Karriere als Profi-Videospieler mittlerweile beendet, aber seinen Namen zur Marke gemacht. Es gibt „Fatal1ty“-Computerbauteile und „Fatal1ty“-Kopfhörer: Für weniger als 100 Dollar kann jeder ein Stück vom tödlichsten Typ im Internet haben.
Längst hat die Industrie erkannt, welcher Wert in der Sehnsucht nach virtueller Identität steckt. Im Werbespot für die Kopfhörer zieht Wendel durch die nächtliche Großstadt, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Gelegentlich begegnet er Passanten, deren Daten auf einem futuristischen Bildschirm aufploppen, als seien sie für eine Geheimarmee rekrutiert worden. Sei ein Auserwählter, so die Botschaft, Teil einer Elite. Sei „Fatal1ty“.
Manische Weltraumkrieger
Manchmal ersetzen Pseudonyme auch die wahre Namensidentität. In den Achtzigern stieg der ehemalige Bodybuilder James Hellwig für die World Wrestling Federation in den Ring. Als manischer Weltraumkrieger „Ultimate Warrior“ trat er gegen Stars wie Hulk Hogan an. 1993 änderte Hellwig seinen bürgerlichen Namen offiziell zu „Warrior“. Ohne Nachnamen. Hintergrund war ein Streit mit seinem Arbeitgeber um die Rechte an der Ring-Persona des Wrestlers. Die Namensänderung sollte bei anstehenden Prozessen um Tantiemen helfen.
Und wer unter den Jüngeren kennt noch Herbert Frahm? Nach Beginn der NS-Diktatur ging der 19-Jährige ins Exil nach Oslo, um dort einen sozialistischen Stützpunkt aufzubauen. Als Tarnnamen wählte er Willy Brandt – und legte ihn bis zum Rest seines Lebens nicht mehr ab.
Bunte Mützen als Tarnung
Warum fiel die Wahl des späteren Bundeskanzlers ausgerechnet auf dieses Pseudonym? In seiner Autobiografie „Mein Weg nach Berlin“ schreibt Brandt, er habe den Namen nach Absprache mit engsten Freunden gewählt. Kein Wort zu den Beweggründen, nichts zu den etymologischen Unterschieden. Während Willy sich über Wilhelm vom althochdeutschen Wort für „Entschlossenheit“ ableitet, steckt in Herbert das „berühmte Heer“ – kein guter Name für einen Antifaschisten im Untergrund. „Meine nicht sehr intelligent gewählte Verkleidung bestand in einer bunten Mütze“, beschreibt Brandt seine äußerliche Tarnung.
Pseudonyme im Netz sind nicht zuletzt ein Spiel mit Varianten der eigenen Identität. Das Spiel kann harmlos sein – oder auch lebenswichtig. Ebendeshalb greift die Forderung nach Klarnamen im Netz zu kurz: Denn einerseits können Tarnnamen strafbare Handlungen und verbale Gewalt decken, andererseits bieten sie Schutz. Nicht nur bei Kritik am Arbeitnehmer, sondern auch, wenn Zensur droht oder der Zugriff von Unrechtsregimen. Nicht ohne Grund treten viele der aktuell Demonstrierenden in Hongkong unter Tarnidentitäten auf. Etwa der Nutzer „Thomas dgx yhl“, der mit dem spöttischen Marschlied „Glory to Hong Kong“ die zentrale Hymne der Protestbewegung schuf.
Das Netz als Schutzraum
Anderes Beispiel: queere Menschen. Sie können unter Pseudonymen eine Seite ihrer sexuellen Identität ausleben, für die sie offline auch in der westlichen Welt immer noch mit Diskriminierung und Gewalt rechnen müssen. Und sie können anderen helfen, Ängste zu überwinden.
So wie bei „DEERE“. Die Dragqueen aus den USA filmt sich für die Streamingplattform Twitch mehrmals pro Woche für Tausende Zuschauer dabei, wie sie Horrorspiele am Computer spielt. Seit mehr als zwei Jahren macht sie das schon. Mittlerweile hat sie eine ganze Gemeinschaft von videospielenden Dragqueens und -kings ins Leben gerufen. „Vorher fiel es mir schwer, dieser Seite von mir Ausdruck zu verleihen“, mailt sie auf Nachfrage. Normalerweise sei sie schüchtern, introvertiert. Weit entfernt von „DEERE“ mit ihren opulenten Perücken und Wimpern.
Gemeinschaft der Dragqueens
In ihrem Pseudonym trifft das altertümliche Prinzip der Tiernamen auf das moderne Spiel mit dem Unbekannten: „DEERE“ ist abgeleitet von „deer“, englisch für Hirsch. Sie sei schon immer von der Symbolkraft des Tiers beeindruckt gewesen. „Miss DEERE“ geschrieben klinge der Name gleichzeitig ähnlich wie Mystery. „Und die Großschreibung ist für den dramatischen Effekt.“
Sie habe sich schon immer von den Möglichkeiten der Videospiele inspiriert gefühlt, von der Freiheit, mit wenigen Klicks das eigene Geschlecht bestimmen zu können. Die Regeln, in die man hineingeboren werde, hätten im Digitalen keine Bedeutung: „Wie bei Drag kann ich sein, was immer ich will“, sagt sie.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Was „DEERE“ als ein Gefühl persönlicher Freiheit beschreibt, ist mit dem sogenannten Transhumanismus eine ganze philosophische Strömung geworden. „Oft steckt hinter digitalen Identitäten der Wunsch, die Grenzen des eigenen Körpers aufzulösen“, sagt der Schweizer Religionswissenschaftler Oliver Krüger. Manchmal benötige man dafür nicht mehr als einen anderen Namen.
Die Grenzen des Körpers verlassen
In seinen Büchern analysiert Krüger die Hoffnungen, die der technische Fortschritt weckt. Seit Jahrzehnten würden Theoretiker und Hollywoodproduktionen wie „Transcendence“ mit Johnny Depp eine Zukunft an die Wand malen, in der die Technik die Evolution fortsetzt – mehr oder weniger optimistisch.
Auch der israelische Historiker Yuval Noah Harari untersucht in seinem Buch „Homo Deus“, wie der Mensch sich im Bestreben nach Selbstoptimierung und -ermächtigung immer mehr der Technik hingibt. Auf der einen Seite will er mittels Digitalisierung die Kontrolle über sich und die Welt erlangen: über das eigene Erscheinungsbild, Krankheiten und Naturkatastrophen. Gleichzeitig lagere er die Kontrolle zunehmend an Algorithmen aus. Irgendwann werde das Verhältnis kippen, so Harari, und der Computer ersetze den Menschen.
Die Zukunftsvorstellungen des Transhumanismus reichen bis hin zu Supercomputern, in die Menschen ihr Bewusstsein hochladen. Das Ziel sei die Unsterblichkeit, der Mensch als gottgleiches Wesen, sagt Religionsforscher Krüger. Die Körperhülle ist dann nur noch ein Überbleibsel aus der Vergangenheit.
Was hat das mit Pseudonymen zu tun? Die transhumanistischen Allmachtsfantasien offenbaren die gleiche Sehnsucht, den Wunsch nach uneingeschränkter Selbstbestimmung. Wobei die Onlinenutzer meist bescheidener auftreten als die Philosophen. Im Namensranking schafft es „Jesus“ gerade noch auf Platz 32. „God“ liegt abgeschlagen auf Rang 55, elf Plätze hinter „Batman“.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false