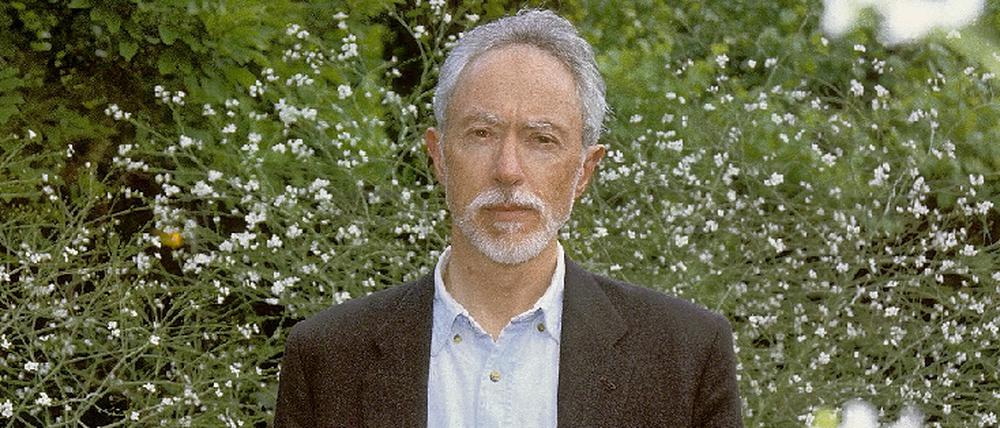
© Holland. Hoogte/laif
J.M. Coetzees „Sommer des Lebens“: Mein Name sei Avatar
Autobiografisches Spiegelkabinett: J.M. Coetzees „Sommer des Lebens“
Wer immer eines Tages das letzte Wort über J. M. Coetzee und seine Verdienste zu sprechen gedenkt, wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass schon eine Reihe von abschließenden Urteilen existiert. Nehmen wir zum Beispiel das Verdikt der französischen Literaturwissenschaftlerin Sophie Denoël, die in Anspruch nimmt, Coetzees mittelprächtigen pädagogischen Eros 1976 in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung an der Universität Kapstadt kennen gelernt und obendrein ein kurzes Verhältnis mit ihm unterhalten zu haben. „Generell würde ich sagen, dass es seinem Werk an Kühnheit mangelt. Die Kontrolle über die einzelnen Elemente ist zu straff. Man bekommt nirgends das Gefühl, dass er als Schriftsteller sein Medium umgestaltet, um zu sagen, was noch nie gesagt wurde, was für mich das Zeichen großer Literatur ist. Zu kühl, zu ordentlich, würde ich sagen. Zu einfach. Zu leidenschaftslos.”
Es mag Gründe geben, das didaktische Talent des südafrikanischen Nobelpreisträgers, der damals tatsächlich als Professor aus den USA in seine Heimatstadt zurückgekehrt war, in Zweifel zu ziehen. Vielleicht verleitet einen die Konstruiertheit seiner Romane auch dazu, sie grundsätzlich als zerebral abzutun. Die Sache ist nur, dass es Sophie Denoël nie gegeben hat. Sophie ist, wie alle fünf Figuren, die in „Sommer des Lebens“ (Summertime) einem Biografen n Auskunft darüber geben, wie sich ihre Lebenswege mit denen des verstorbenen Coetzee kreuzten, eine Erfindung von J. M. Coetzee. Am heutigen Dienstag feiert der Schriftsteller seinen 70. Geburtstag. Nicht nur durch die fiktiven Interviews des Biografen, der den echten Coetzee nie getroffen hat, wird er selbst zur Erfindung.
Zwar hat der Coetzee im Buch von „Mr. Cruso, Mrs. Barton & Mr. Foe“ bis zu „Schande“, all die Bücher geschrieben, die dessen schriftstellerischen Ruhm begründen. Als ewiger Junggeselle unterscheidet er sich jedoch deutlich von dem aktenkundigen Coetzee, der 23-jährig heiratete, mit seiner (später geschiedenen) Frau Philippa Jubber eine Tochter und einen Sohn bekam, den mit 33 Jahren tödlich verunglückten Fotografen Nicolas Coetzee – Ereignisse, die im Buch trotz der exzessiven intimen Informationen, die der Leser unter anderem über das tölpelhafte Sexualleben eines „hölzernen Mannes“ erhält, keine Rolle spielen.
Was ist das für ein Buch? Eine Autobiografie? Ein Roman, wie die Genrebezeichnung lautet? Oder ein sogenanntes Memoir, das zwischen beidem schwankt? Die ironische Mahnung, dass es immer nur vorletzte letzte Worte geben kann? Selbsterhöhung durch dauernde lustvolle Selbsterniedrigung? „Ein Junge“ und „Die jungen Jahre“, die beiden ersten Bände von Coetzees autobiografisch auftretenden Schriften, bieten keinen Anlass, an den Grundfakten darin zu zweifeln. Coetzee adressiert sich darin lediglich in der dritten Person. Das Er, sagte er einmal im Gespräch mit David Attwell, empfinde er sogar näher am Ich, da eine solche „autrebiography“ Schatten zurück auf die „autobiography“ werfe.
„Sommer des Lebens“ radikalisiert diese Haltung gleich doppelt. Es ist die Dritten übereignete Selbstbefragung eines lebenden Autors, der sich durch die Post-mortem-Perspektive gleichsam aus seinem eigenen Buch herausgeschrieben hat – und es ist das „Second Life“ eines literarischen Avatars, der alternative Schicksale erkundet. „In einem erweiterten Sinn ist jedes Schreiben Autobiografie“, hat Coetzee gegenüber Attwell in „Doubling the Point“ bekundet. „Alles, was man schreibt, Kritiken und Fiktionales eingeschlossen, schreibt einen, indem man es schreibt. Die wirkliche Frage lautet: Dieses ungeheure autobiografische Schreibunternehmen, das ein Leben ausfüllt, dieses Unternehmen einer Selbstkonstruktion – ergibt es nur Fiktionen? Oder gibt es unter den Fiktionen des Selbst, den Versionen des Selbst, die sich daraus ergeben, eigentlich welche, die wahrer sind als andere? Woher weiß ich, dass ich die Wahrheit über mich herausgefunden habe?“
In solchen Fragen zeigt sich nicht die déformation professionelle eines unverbesserlichen Geschichtenerzählers, der sich scheut, klare Worte für das ihm Widerfahrene zu finden und lieber in trüben metafiktionalen Gewässern fischt. Es ist der skrupulöse Versuch, sich auf den Grund zu gehen – und dabei zusehends den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Problematik von „Sommer des Lebens“ ist dabei keine andere als die des Romans „Mr. Cruso, Mrs. Barton und Mr. Foe“, in der die schiffbrüchige Susan Barton nach der Heimkehr von einer einsamen Insel einem Schriftsteller namens Foe ihre Erlebnisse in die Feder zu diktieren versucht. Mit Foe, hinter dem sich der „Robinson Crusoe“-Autor Daniel Defoe verbirgt, gerät sie über das Verhältnis von Erfahrung und literarischer Ausschmückung in Streit. Und es ist die Problematik, die ihn rein analytisch auch in seinem großen Essay „Bekenntnis und Zwiespalt der Gedanken“ – in dem Band „Was ist ein Klassiker?“ – über Konfessionen bei Tolstoi, Rousseau und Dostojewski beschäftigt.
Etwas wird behauptet – und sofort wieder in die Schwebe des Zweifels gerückt. Dinge werden ausgesprochen – andere sind gemeint. Eine Polyfonie der Perspektiven entsteht wie in seinem zuletzt erschienenen „Tagebuch eines schlimmen Jahres“, das sein eigenes Verwirrspiel mit einem Coetzee-Double trieb.
Auf der Ebene der Logik wirkt das möglicherweise wie ein Widerspruch, auf der Ebene der Moral wie eine Lüge, und auf derjenigen der Ästhetik wie Beliebigkeit. Doch es handelt sich um eine kalkulierte erzählerische Unschärferelation, bei der die äußere Gestalt eines Mosaiksteins nicht unbedingt etwas über die ihm innewohnende Kraft verrät. So lernt der Leser von „Sommer des Lebens“ in so ergreifenden wie komischen Kapiteln Margot, die (fiktive) Herzenscousine des (fiktiven) Coetzee kennen, mit der er eine unbequeme Nacht in der felsigen südafrikanischen Ödnis verbringt, seine zeitweilige Geliebte Julia, den Universitätskollegen Martin und die besorgte Mutter einer brasilianischen Englischschülerin.
Sie alle entwerfen das Bild eines unangenehm verschlossenen Mannes, das sie gegenüber dem Biografen aus- und übermalen. Nur einen winzigen Ausschnitt davon sollte man für bare Münze nehmen. Wenn man den Darstellungen aber etwa entnimmt, wie sehr hier jemand uneins mit seiner Leiblichkeit ist, begreift man etwas von Coetzees Zerfallenheiten.
Als der überzeugte Vegetarier 1997 an der Princeton University zu zwei der berühmten „Tanner Lectures on Human Values“ eingeladen wurde, hielt er nicht philosophische Vorträge über das Unrecht, das Menschen begehen, indem sie Tiere großindustriell vernichten. Er kleidete seine Einlassungen vielmehr in den fiktiven Universitätsvortrag der verschrobenen Schriftstellerin Elizabeth Costello, die ihr Unbehagen an dem Massenmord als eine Frage der Empathie artikuliert – gegen ihre im Publikum sitzende Schwiegertochter, eine analytische Philosophin.
Seit Platons Verbannung der Dichter aus dem philosophischen Diskurs dürfte die akademische Denkerzunft nicht mehr so in ihrem Selbstverständnis erschüttert worden sein. Jedenfalls diskutiert sie seit Coetzees fiktiven Einlassungen ganz real, ob rationale Begründungen in der Moralphilosophie ausreichen. Stephen Mulhalls Studie „The Wounded Animal – J. M. Coetzee and the Difficulty of Reality in Literature and Philosophy“ legt davon Zeugnis ab, ebenso der Aufsatzband „Philosophy and Animal Life“.
Psychologisch könnte man Coetzees Strategien auch als ein obsessives Sich-unkenntlich-Machen in der Multiplikation deuten. Steckt in ihnen nicht auch eine seltsame Mischung aus Eitelkeit und Scham, ein narzisstischer Antinarzissmus? Der Autor, der schreibend sich selbst schreibt, ist auch ein privilegierter Leser: zumindest teilweise fähig, die Täuschungen zu durchschauen, die er anderen in seinem Spiegelkabinett zumutet. Aber selbst wenn wir ihnen aufsitzen, erfahren wir etwas von unserer eigenen Wahrheit. Darin liegt das große Vergnügens dieses Buchs.
J. M. Coetzee: Sommer des Lebens. Roman. Aus dem Englischen von Reinhild Böhnke. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2010. 297 Seiten, 19,95 €.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false