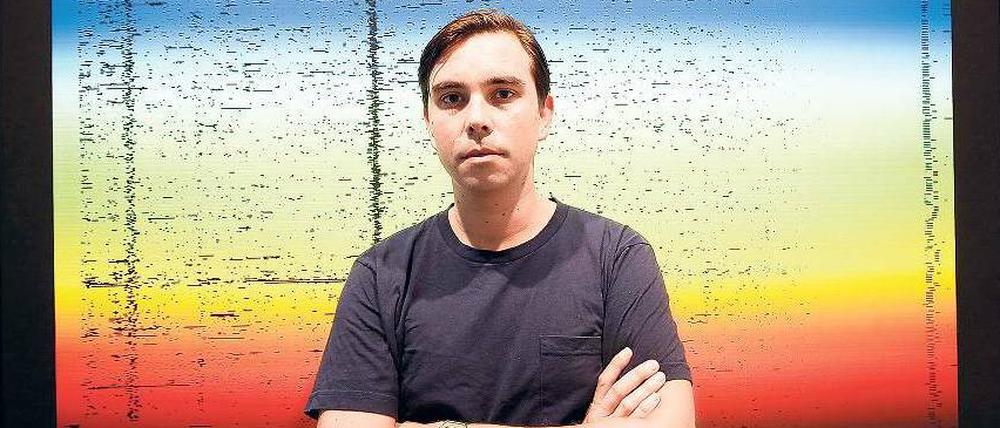
© W. Kumm/dpa
Der britische Künstler James Bridle: „Die Datengläubigkeit ist fast religiös“
Der britische Künstler und Überwachungs-Kritiker James Bridle spricht über seine Ausstellungen in Berlin, Edward Snowden und Kameras im öffentlichen Raum.
Der britische Publizist und Künstler James Bridle, Jahrgang 1987, hat sich als Anti-Überwachungs-Aktivist einen Namen gemacht, auch als Redner auf Veranstaltungen zu Internetthemen und Medienkunst. Seine Recherchen sind zunehmend Grundlage seiner Werke. In Berlin werden seine Visualisierungen derzeit an gleich zwei Orten präsentiert. Die Nome-Galerie (Dolzigerstr. 31, bis 5.9., Di – Sa, 15 – 19 Uhr) zeigt Bridles erste Einzelausstellung in Deutschland, "The Glomar Response". Die Arbeiten befassen sich mit Geheimdienstem, Einwanderungspolitik und Überwachungstechnologien. U.a. macht Bridle das Ausmaß zensierender Schwärzungen in CIA-Dokumenten sichtbar, auf riesigen, regenbogenfarben bedruckten Leinwänden. Das Ergebnis ähnelt den „Fraunhofer Lines“, der graphischen Darstellung von Sonneneinstrahlung. Vor den Kunst-Werken (Auguststr. 69, bis 30.8.) hat Bridle für die Ausstellung Fire and Forget den Schatten einer Überwachungsdrohne auf die Sraße gezeichnet – um daran zu erinnern, dass Kontrolltechnologien kaum je sichtbar werden.
Mr. Bridle, in Ihrem Video „Seamless Transitions“ zeigen Sie computeranimierte Visualisierungen von geheim tagenden Abschiebegerichten in England oder einem Terminal des Londoner Flughafens Stansted, von dem aus jede Nacht Abschiebemaschinen losfliegen. Wieso ist es wichtig, diese unsichtbaren Orte zu sehen?
Ich habe ein tiefes Misstrauen gegenüber allem, was vorsätzlich verschleiert wird. Ob in der Technologie wie bei versteckter Überwachung, in der Rechtsprechung wie bei geheimen Migrationsgerichten oder in sozialen Prozessen, bei denen es ein informationelles Ungleichgewicht zwischen den Akteuren gibt. Unser gesamtes Überwachungskonzept basiert darauf, dass niemand weiß ob, wie und wann man beobachtet wird. Das ist nicht nur persönlich und psychologisch destabilisierend, es hat auch schlimme Folgen für unsere Demokratie.
Der Soziologe Michel Foucault beschrieb schon in den 70er Jahren panoptische Überwachungs- und Kontrollmechanismen, bei denen sich der Überwachte selbst nach der herrschenden Norm diszipliniert. Ist das heute noch genauso?
Es hat eine Dematerialisierung der Strukturen gegeben. Foucault ging es um Formen der Architektur, des Urbanen. Heute können wir nicht mehr irgendwo hinzeigen und sagen: „Da, das ist Überwachungsarchitektur“, weil diese sich in unseren elektronischen Geräten abspielt. Deshalb bestehen Edward Snowdens Enthüllungen vor allem aus Powerpoint-Präsentationen. Wie soll man über etwas reden, das nicht greifbar ist? Ich versuche, solche komplexen Systeme erfahrbar zu machen. Die Orte von „Seamless Transitions“ etwa sind unzugänglich, also habe ich sie anhand von Augenzeugenberichten und Dokumenten rekonstruiert.
Für die Arbeit „Fraunhofer Lines“ haben Sie den 600-seitigen US-Senats-Report zu Folter in Guantanamo abstrahiert, um die schiere Menge von Zensurbalken sichtbar zu machen.
Die Visualisierung macht die Vorgänge konkret, gerade in der Abstraktheit der Bilder. Wer etwas sieht, ist auch in der Lage, darüber zu sprechen.
Wird denn darüber gesprochen?
In Großbritannien überhaupt nicht. In London kann man keine zehn Meter gehen, ohne gefilmt zu werden. Wir sind das meistüberwachte Land der Erde, und wir finden das in Ordnung. Seit den Snowden-Enthüllungen wurden sogar zwei weitere Gesetze verabschiedet, die staatliche Überwachung vereinfachen. In den USA hat zumindest eine Diskussion begonnen. In Deutschland wiederum ist die Skepsis in der Bevölkerung groß und die Debatte kritisch. Auch die Privatsphäre-Gesetze hier sind stark.
Sie sind Londoner, wie kommen Sie in Kontakt mit Überwachungssystemen?
Abgesehen von der Kamera am Ende meiner Straße, durch meine Arbeit. Bevor ich mich mit Überwachung beschäftigt habe, habe ich mich für Architektur interessiert. Ich machte Spaziergänge durch die Stadt und merkte: Wenn du Gebäude abseits von Touristenattraktionen fotografierst, wirst du von Sicherheitsleuten belästigt. Ein Paradox: Alle finden es in Ordnung, dass überall Kameras hängen, aber wenn einer zurückfilmt, wird man als Bedrohung wahrgenommen.
Mit Unsichtbarkeit und Bedrohung beschäftigen Sie sich öfter. Vor den Berliner Kunst-Werken haben Sie den Schatten einer Drohne auf die Straße gezeichnet.
Die Drohne ist eine gute Analogie für Netzwerke, wie wir sie aus der Überwachungsarchitektur kennen: Sie ist unsichtbar, vernetzt und nicht verantwortlich zu machen. Sie ist kein moralischer Akteur – genau das macht sie gefährlich.
Den meisten Leuten ist es egal, ob sie überwacht werden oder nicht. Was ist denn eigentlich so schlimm daran?
Grundsätzlich gibt es ein Menschenrecht darauf, nicht permanent kontrolliert und observiert zu werden. Noch wichtiger: Überwachungsstrukturen anzulegen und auf das Gute im Menschen zu vertrauen, das funktioniert nicht. Wie viele Mitarbeiter hat alleine der NSA schon entlassen müssen, weil die Leute mit der Technik ihre Ehepartner, Nachbarn oder Freunde ausspioniert haben. Diese Systeme werden immer missbraucht werden.
Nahezu jede Studie zu Kameraüberwachung zeigt: Sie ist wirkungslos. Warum glauben die Sicherheitsbehörden daran?!
Weil es so aussieht, als täte man etwas Sinnvolles. Das eigentliche Problem dabei ist unsere fast religiöse Datengläubigkeit. Wir denken, je mehr Daten wir sammeln, desto tiefer ist unsere Erkenntnis der Realität. Irgendwie soll datengetriebene Information wertvoller sein als andere, also stützen wir alle unsere Entscheidungen darauf. Es wäre gut, wenn mehr Menschen technologische Prozesse verstünden, noch wichtiger ist es aber zu verstehen, dass es auf jedem Level komplexe Verzerrungen und Grauzonen gibt.
Und zu akzeptieren, wie komplex die Wirklichkeit ist?
Vor sechs Jahren habe ich versucht, das zu visualisieren, indem ich für eine Lesung den Wikipedia-Artikel zum Irak-Krieg samt seiner Bearbeitungshistorie ausgedruckt habe: 12 Hardcover-Bände, 7000 Seiten. Das zeigt doch, dass unser Wissen ständig im Fluss ist. Es gibt keine stabile Version der Wahrheit. Für uns heißt das: Ja, wir sollten an besseren Visualisierungen arbeiten, um Daten verständlicher zu machen. Und dabei nicht vergessen, dass auch Daten instabil sind.
Sehnen sich Menschen für gewöhnlich nicht nach mehr Einfachheit?
Die Welt ist nicht komplexer geworden, wir sehen aber mehr von ihrer Komplexität. Die Nachfrage nach simplen Narrativen steigt, deshalb ist es kein Zufall, dass Verschwörungstheorien und Extremismen gerade einen enormen Zulauf haben. Auch da besteht die Lösung nicht in mehr Information, sondern darin, dass wir die Ungenauigkeit vorhandener Information akzeptieren. Und dass wir jedem skeptisch begegnen, der behauptet: „Ich verstehe alles, lass mich mal machen.“
Das Gespräch führte Fabian Federl.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false