
© Splitter
Neue Science-Fiction-Comics: Frau von Welt und Mann im All
Ein Rückblick auf das Science-Fiction-Comic-Jahr, das von außergewöhnlich vielen Neuerscheinungen von Autorinnen geprägt war - und manchen Abwehrreaktionen.
Ende 2018 standen anlässlich des 12. Comicfestivals in Hamburg Themen zwischen Gender Politics und Science-Fiction im Fokus. Neben der Beschäftigung mit der Darstellbarkeit geschlechtlicher Identitäten im zeitgenössischen Comic wurden etwa Larissa Hoffs Illustrationen zu Margaret Cavendishs "The Blazing World" (1668) gezeigt, dem ersten von einer Frau verfassten utopischen Werk, und zudem einem Frühtext feministischer Philosophie.
Die Fragen, ob Cavendish Mary W. Shelley den Titel Mutter der Science-Fiction streitig macht oder warum Alan Moore und Kevin O'Neill dem Buch in ihren Comics über die "League of Extraordinary Gentlemen" ihre Referenz erwiesen, brauchen hier nicht weiter zu interessieren; zwei Frauen unter den Pionieren der Zukunftsliteratur sind etwas, das zählt.
Aber scheinbar nicht genug. So hatte die Hansestadt nämlich auch Aminder Dhaliwal zu Gast, die sich in Kommentaren unter ihren auf Instagram veröffentlichten Comic-Strips über eine Welt ohne Männer, "Woman World", Androhungen von Vergewaltigung oder Mord ausgesetzt sah.
Und das alles wegen eines erstmals am Internationalen Frauentag 2017 veröffentlichten Comics, der ein nicht gerade unübliches SF-Szenario durchspielt, also quasi "Y – The Last Man" minus Eins, um mal im Comicbereich zu verbleiben.
Ein Schritt vor und zwei zurück
Was sie zu einer weiteren Kampfmittelbeseitigungskraft im Minenfeld der Comics macht, denn es sind vorwiegend Künstlerinnen, welche die Hauptlast beim Wiederaufbau der von kämpfenden Männern hinterlassenen Ruinen schultern, die zudem von einem Gespinst aus einer nicht von ihren Pfründen lassen wollenden Altherrenmentalität überwuchert sind.
Ein Problem, mit dem vor allem im Comic aktive Frauen, aber ebenso nicht-weiße oder andersgeschlechtliche Personen nicht erst seit der sich gegen alles irgendwie von einer heteronormativen Doktrin abweichende und als Comicsgate firmierenden Bewegung konfrontiert sind.
In dieser Hinsicht reichen sich SF und Comics einmal mehr die Hände, wenn auch in wenig rühmlicher Art. Beide können sich nur schwer von dem Klischee befreien, eher männliche Interessen zu bedienen, und warten mit heftigen Abwehrreaktionen auf, sobald jemand diesen Mythos in Frage stellt.
Im englischsprachigen Raum manifestierte sich dies zwischen 2013 bis 2017 in der Sad Puppy Initiative, mit der konservative Fans versuchten, die Shortlists der Hugo-Awards von politischen Themen freizuhalten, was sich insbesondere in der mit der radikalen Rechten liebäugelnden Abspaltung der Rabid Puppies unweigerlich gegen Frauen und Minderheiten richtete.
Nur durch zahlreiche Stellungnahmen verschiedener Szenegrößen sowie die Entscheidung der Community, in beeinflussten Listen gegen eine Vergabe des Awards zu stimmen, gelang eine deutliche Positionierung gegen die hanebüchenen Forderungen.
Dass eine solche Positionierung wirkt, war in den letzten Jahren deutlich zu sehen. Auch 2019 stand bei den Nominierungen wieder Perspektivenvielfalt im Fokus und die Entscheidung, nicht-männlich und nicht-weiße Stimmen ausdrücklich zu begrüßen statt zu marginalisieren, hat dem Genre neues Leben eingehaucht.
Den internationalen Markt im Blick
Schaut man sich dagegen die Shortlist des Kurd-Laßwitz-Preises an, ist es fast verwunderlich, dass es nicht noch mehr deutsche Autorinnen wie die mit "When We Were Starless" in der Kategorie Beste Erzählung für den Hugo nominierte Simone Heller direkt auf den internationalen Markt zieht.
Inländische Comic-Verleger scheinen ebenfalls erkannt zu haben, dass hier unentdecktes Potenzial schlummern könnte. Und so gab es mit Frauke Berger, Asja Wiegand, Katrin Gal oder Olivia Vieweg sowie dem Duo Cristin Wendt und Ronja Büscher allein im Zeitraum von 2018 bis 2019 fünf Neuerscheinungen beziehungsweise erweiterte Neufassungen von sich mit SF-Themen beschäftigenden Künstlerinnen, was einigermaßen außergewöhnlich ist.
International, und das ist eben immer auch richtungsweisend – siehe auch die weiter unten erwähnte englischsprachige Ausrichtung des Werkes von Paul Paetzel und Marc Hennes – ist diese Tendenz ebenso zu beobachten: Inés Estrada, Tillie Walden und Mickey Zacchilli sowie die bereits erwähnte Aminder Dhaliwal legten gleichfalls SF-Comics vor.
Darüber hinaus gab es das fast völlig untergegangene Deutschland-Debüt des Manga-Altmeisters Shintaro Kago zu vermelden, sowie die Rückkehr der Routiniers Tsutomu Nihei und Enki Bilal, die aber bereits ausgetretene Pfade zumindest teilweise verlassen. Zep und Dominique Bertail dagegen wildern in Gefilden, die einst einem wie Bilal Obdach boten.
Heran-Wachstumsschübe
Im Folgenden schauen wir uns einige der herausragenden Neuerscheinungen des vergangenen Science-Fiction-Comic-Jahres genauer an.
Frauke Bergers "Grün"
Frauke Bergers "Grün"
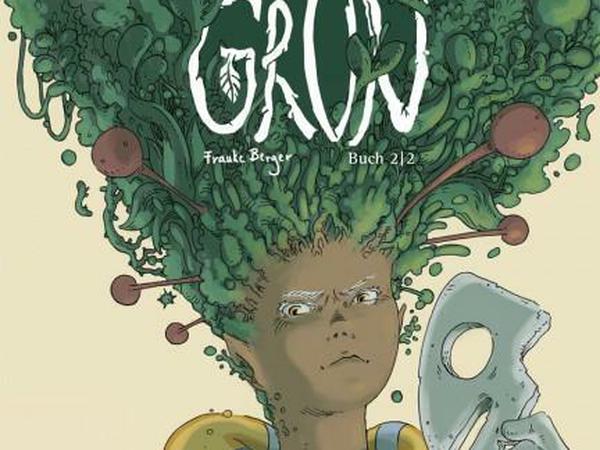
© Promo
Es sieht aus, als ob Anna Haifisch und Olivia Vieweg, zwei der innovativsten und stilsichersten Kräfte im deutschen Comic, sich in Zukunft wärmer anziehen müssen. Denn Frauke Berger lässt in "Grün" (Splitter, zwei Bände, 56/68 S., je 15,80 €) Panels zu Tönen, auch Farbtönen, tanzen, die in unseren Breitengraden bisher kaum oder gar nicht hörbar waren. Rhythmisch bewegt sie sich dabei auf einem Niveau von Kompositionsmeistern wie beispielsweise Andreas Martens.
Berger psychedelisiert stilistisch nah an Philippe Caza oder Moebius, letzterer Einfluss musste jedoch erst die transformierende Schule von Hayao Miyazaki durchlaufen, um von unter anderem Brandon Graham, James Stokoe oder Sloane Leong nach Bearbeitung mittels mangafiziertem Succus gastricus wieder ausgespien zu werden, so geschehen in der Serie "Prophet" (ab 2012).
Daraus resultiert dieser aus einer falsch verdauten Lynch-Verfilmung spinnerhafte Wüstenplanet-Mystizismus – nur wenige werden sich vermutlich durch das zu gigantischen Proportionen aufgeblasene Jugendbuch von Frank Herbert gewühlt haben.
Aber weil Berger im Gegensatz zu Herbert keine Männer messianisiert, wie es auch ihre Schwester im Geiste, Sloane Leong in ihrem dekolonialisierenden SF-Epos "Prism Stalker" nicht tut, ist "Grün" zudem angenehm fernab von jeglicher Erlöser-Mystifizierung und daher viel besser. Herberts durchaus beeindruckendes World Building hat Berger jedoch gleichfalls drauf, und so entsteht tatsächlich eine ganz eigene Welt.
Berger lässt negativen Raum für sich arbeiten, etabliert eine empathische Koloration, wandert keine ausgetretenen Genre-Handlungspfade ab, wie es in der deutschen Comic-/Phantastik-Szene sonst en vogue ist, und „Oh Gott, da ist jemand, der eine eigene Vision vermitteln kann, das lässt sich nie und nimmer verkaufen, kann sie nicht Drachen oder wenigstens ein paar fucking Elfen reinbringen“.
Muss sie gar nicht. Ihre Erzählung um eine junge Frau, die auszieht, um einen, nun ja, recht sandigen Planeten von einer raumgreifenden Pflanzendeformation zu befreien – was hier durchaus bildhaft wie titelgebend zu verstehen ist – punktet mit Diversität in der Charakterzeichnung und beeindruckender Synthese von Wort und Bild, weil sie das Lettering gleich mit besorgt, und verzichtet dabei auf die üblichen machiavellistischen Sandkastenspiele straff organisierter und oftmals männlicher Zukunftsvisionen. (ORi)
Olivia Viewegs "Endzeit"
Olivia Viewegs "Endzeit"

© Promo
Zombies haben sich längst von aller gesellschaftskritischen Konsumsymbolik freigeschlurft und belagern seit gut einem Jahrzehnt die Popkultur. Da können einem die untoten Virenschleudern und das mit ihnen einhergehende permanente Neuerzählen eines unbarmherzig-brachialen Naturzustands, der nur von kulturellen Instanzen in Schach gehalten wird, langsam auf die Nerven gehen.
In Olivia Viewegs "Endzeit" (Carlsen, 288 S., 22 €), einer erweiterten Langfassung ihrer 2011 eingereichten Diplomarbeit, wird die Apokalypse aber so berückend in Szene gesetzt, dass man geneigt ist, das Genre doch nicht totzusagen.
Die introspektive Überlebensreise zweier junger Frauen durch die hochsommerliche Thüringer Landschaft zwischen Weimar und Jena – spektakulär koloriert von Ines Korth und Adrian vom Baur – fängt in weichen Bleistiftkonturen das Überwinden äußerer wie innerer Hindernisse ein und verändert das Survivalsetting hin zu einer universellen Erzählung über Trauma und Schuldverarbeitung. Das Ergebnis wäre stellenweise fast zu süß und gelegentlich etwas plakativ, würde alles nicht stets in überzeugender Aufrichtigkeit aufgehen.
Dass die Dynamik zwischen der naiven Vivi und der resoluten Eva mühelos über fast 300 Seiten trägt, verdankt sich der in Manga-Manier perfektionierten Ausdrucksstärke, mit der Vieweg die mitunter skizzenhafte Mimik und Gestik zum eigentlichen Erzählmittel macht.
Tatsächlich kommen ganze Passagen nonverbal aus, wenn alles, was die Figuren bewegt, visuell auf den Punkt gebracht zwischen ihnen in der Luft hängt, was zudem persönliche Vorgeschichte enthüllt, ohne sich erst mit Expositionen zur Weltlage aufzuhalten.
Handlungen wie Vivis Flucht aus der psychiatrischen Anstalt, deren Leiterin sie als Tochterersatz verhätschelt, oder Evas spontaner Entschluss, ihr altes Leben in einer glühenden Flammengloriole aufgehen zu lassen, sind derart tiefgehend vorbereitet, dass die Hintergründe der Epidemie ohnehin gleichgültig sind.
Zudem hilft gerade der Einsatz haptischer Elemente – Ameisen auf nackter Haut, Flipflops im hohen Gras – den absurden Widerspruch für die Leser*innen spürbar zu machen, dass das Grauen der allgegenwärtigen Gefahr immer wieder in kindliches Staunen über die davon völlig unbeeindruckte Schönheit der idyllischen Kulisse umschlagen kann.
So prangt über dem Leben und Sterben Tag und Nacht der konturlose Himmel, die leuchtenden Farben durchsetzt mit Federwolken und Sternen, ein keinesfalls gleichgültiger, sondern eher tröstlicher Spiegel der Welt. (HKB)
Asja Wiegands "Sterne Sehen"
Asja Wiegands "Sterne Sehen"

© Promo
Asja Wiegand kam, wie auch Olivia Vieweg oder Katja Klengel, über in Deutschland veröffentlichte Manga zum Comic, was unter anderem maßgeblich dem Erfolg von "Sailor Moon" ab 1998 zu verdanken ist.
Und so wie Autorin und Zeichnerin Naoko Takeuchi bei "Sailor Moon" mit Sailor Venus oder Sailor Merkur gleich das Sonnensystem personifizierte – Sailor Pluto entstand vor 2006 und der Aberkennung des Planetenstatus durch die Internationale Astronomische Union – hat nun Asja Wiegand in "Sterne Sehen" (Zwerchfell, zwei Bände, 70/82 S., je 10 €) keineswegs die gerade im franko-belgischen Comic oft übliche Darstellung einer mit physischer Gewalt konfrontierten Figur im Titel verbalisiert, sondern den Wunsch nach der Begegnung mit einer nicht von dieser Welt stammenden Entität subsumiert.
Beim Joggen begegnet Nina der verletzten Ela Era Ean, die von sich behauptet, sie sei mit einem Raumschiff bruchgelandet, und lässt diese bei sich einziehen. Von latenter Anziehung zu Ela angetrieben, aber ebenso an deren Geschichte zweifelnd, schwankt sie fortan zwischen dem Willen zum Glauben und einer stetig an ihr nagenden Skepsis, die sich ebenso im Verhältnis zu ihrer Familie zeigt, die hier durch ihre raumgreifend agierende Schwester verkörpert wird.
Der sehr stimmig und verhalten inszenierte erste Teil lebt vor allem durch dessen Gestaltung von in Grau angelegten Abstufungen sowie dem damit einhergehenden behutsamen Umgang der Figuren miteinander, wobei die gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnissuche in den Dialogen eine weitere Schattierung in diesem Drama vor sommerlicher Kulisse ansichtig macht. Zudem sind in der Haarschneide-Sequenz sowie der luftigen Panelgestaltung Anklänge an Kiriko Nananans lesbische Liebesgeschichte "Blue" erkennbar.
Leider wird in dem im Frühsommer 2018 erschienenen zweiten und abschließenden Band dem Konflikt zwischen Nina und ihrer Schwester zu viel Raum gelassen, was die eher schlanke Erzählstruktur überfordert sowie den Zeichenstil etwas nervös hingeworfen erscheinen lässt und nur durch eine betörend schöne Reminiszenz an die Rakete, mit der Tim und Struppi einst zum Reiseziel Mond aufbrachen, ausgeglichen wird – bei gleichzeitiger Wiederholung des Fremdkontakt-Motivs, welches hier natürlich auch als zaghaft angedeutete homoerotische Beziehung gelesen werden kann.
Die letzte Seite birgt dann allerdings doch ein unerwartetes Finale, bei dem einige Leser*innen sicherlich „I want to believe“ seufzen werden. (ORi)
Tillie Waldens "On A Sunbeam"
Tillie Waldens "On A Sunbeam"
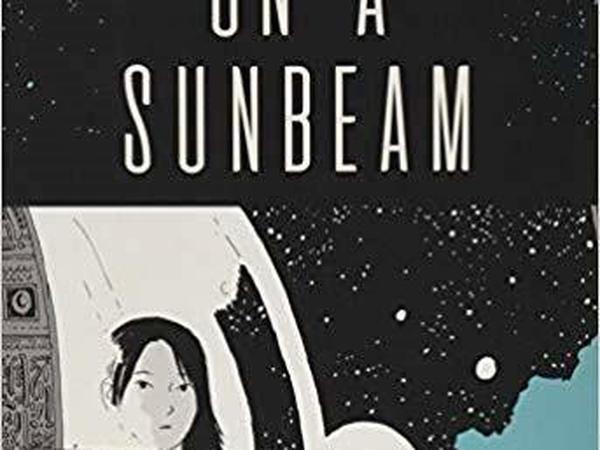
© Promo
Dass Tillie Walden, die von sich selbst sagt, mit SF eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte zu haben, für ihr 2017 als Webcomic und im Folgejahr auch gedruckt erschienenes Adoleszenzdrama "On A Sunbeam" (First Second, 544 S., ca. 25 €) gleich auf der Shortlist der Hugo-Awards landete, kann nicht verwundern.
Die lebhafte Geschichte über Liebe, Freundschaft und die mühsamen Klippen des Erwachsenwerdens hätte ebenso gut von der gerade von einer jüngeren Leserschaft gefeierten Nachwuchsautorin Becky Chambers stammen können. Wie deren "Wayfarers"-Reihe setzt "On A Sunbeam" auf eine ausgestaltete Zwischenmenschlichkeit, macht aber aus der Ausgangssituation einer jungen Frau, die sich einer Raumschiffcrew anschließt und so eine neue Familie findet, doch etwas ganz Anderes.
Dank der verwunschenen und erfrischend wenig technikfixierten Weltgestaltung begleiten wir die Gruppe sympathischer Außenseiter über lange Kapitel hinweg gern bei der Arbeit und leben uns in den Bordalltag ein. Raumschiffe schwimmen gigantischen Fischen gleich durchs All, verfallene Tempel bedürfen der Restauration, namenlose Planeten locken mit atemberaubender Flora und Fauna, doch Protagonistin Mia verheddert sich immer wieder in Erinnerungen an ihre Schulzeit und die erste zarte Romanze mit einer geheimnisvollen Mitschülerin.
Rückblenden und Rahmenhandlung greifen dabei ebenso geschickt ineinander wie die harmonisch konzipierten Panel- und Szenenübergänge, was mit den Grundthemen von Gemeinschaft und Verbundenheit korrespondiert.
Überhaupt nimmt Walden das Weltall als Schauplatz ästhetisch außergewöhnlich ernst. Ihre Szenerien sind mit spärlichen Farben in weite schwarze Flächen eingelassen, die eine fast schon beängstigende Weite vermitteln, als könnten sich die von wenigen feinen Linien gehaltenen Gestalten darin jederzeit auflösen und Teil des mit Sternen, Nebeln und Planeten durchsetzten Raums werden.
Einfache aber detailreiche Bilder, die in sich ruhen, ohne dabei in plakative Melancholie abzugleiten, verleihen der eigentlich simplen Geschichte um Mias Suche nach ihrer verschollenen Jugendliebe eine unerwartete Tiefe.
Nur selten wird diese Allgegenwart des Kosmos gebrochen und durch sattere Farben auf der Planetenoberfläche oder die komplett weißen Hintergründe einer grenzenlos scheinenden Teenagerromanze ersetzt. (HKB)
Inés Estradas "Alienation"
Inés Estradas "Alienation"

© Promo
Alienation meint nicht nur Entfremdung, die englische Vokabel steht ferner für Besitzübertragung. Wird Besitz aber nur gebietend zugeteilt und nicht selbstständig angeeignet, mag die Freude über die Habe am Ende geteilter Natur sein.
Diese unterschiedlichen Definitionen des Begriffs deutet die Mexikanerin Inés Estrada in ihrem gleichnamigen SF-Comic aus, welcher zuerst in sechs Einzelheften und anschließend im Frühjahr 2019 in gesammelter Form erschien (Fantagraphics, 244 S., ca. 18 €).
Estrada, die vorher durch widerborstige und strubbelige Kurzcomics auffiel, wie sie 2013 beispielsweise die entzückenden und mit verspieltem Bodyhorror und Naturverbundenheit im Wortsinn angereicherten "Borrowed Tails" versammelten, befasst sich in "Alienation" mit Virtual Reality und Enhancement und vielen anderen Dingen, die uns das Entkommen aus der unzulänglichen Fleischlichkeit und letztlich der eigenen Endlichkeit ermöglichen sollen.
Am Ende des Weges steht die forcierte Paarung mit einer künstlichen Intelligenz, um, paraphrasiert nach einem anderen mit Transformationen befassten Künstler, David Cronenberg, das neue Fleisch zu erschaffen – welches bei Estrada von der Form her aber eher an Mangaka Hideshi Hinos "Bug Boy" erinnert und dessen Genese vor den Kulissen des letztjährig im April verstorbenen norwegischen Comickünstlers Pushwagner und seiner Tranquilizer-verseuchten Megalopolis der Zukunft "Soft City" stattfindet.
Aber nicht nur, dass bereits Julie Christie 1977 im Film "Demon Seed" Opfer derartiger, wenngleich in diesem Fall männlich-voyeuristischer Gedankenspiele geworden ist, der Gedanke selbst ist vermutlich älter als jede historische Bildschrift.
Nun stellt sich natürlich der Blick auf das Erleiden einer solchen Objektifizierung aus weiblicher Perspektive noch einmal anders dar, und Estrada findet inspirierte wie gekonnt umgesetzte Sequenzen für die semipermeablen Bildwelten ihrer Hauptfigur, die von Halluzinationen und einer gnadenlos auf Wirtschaftlichkeit hin optimierten Realität durchdrungen sind.
Das oft zu offensichtliche Aufspießen von heute beobachtbaren Tendenzen, wie sie dann in Benennungen wie der „Bezos Avenue“ münden, erscheint jedoch redundant – erschließt sich den Leser*innen der Entwicklungsstand einer Welt, deren Prämisse auf heute beobachtbaren Entwicklungen fußt, doch bereits aus der Handlung. (ORi)
Zeps und Dominique Bertails "Paris 2119"
Zeps und Dominique Bertails "Paris 2119"
Mit "Paris 2119" (Schreiber&Leser, 88 S., 19,80 €) versucht sich "Titeuf"-Schöpfer Zep an einer futuristischen Metropolenhommage. Nach dem apokalyptischen Ökothriller "The End" richtet der Schweizer seine Aufmerksamkeit weiter in die Zukunft und entwirft gemeinsam mit Dominique Bertail eine Stadt, die in ihren besten Momenten alle unvereinbaren Kontraste im Paris der Gegenwart heraufbeschwört.
Wo heute unsichtbare soziale Grenzen zwischen drastischer Armut und glänzenden Szenevierteln quer durch die Arrondissements verlaufen, ziehen im Jahr 2119 technische Hilfsmittel scharfe Trennlinien. Große Teile der Stadt sind kaum bevölkert, die wenigen sozialen Knotenpunkte durch Lichtkegel vom künstlichen Dauerregen der Außenwelt abgeschirmt. Das moderne Teleportationssystem Transcore hat physische Ortswechsel nahezu abgelöst und die ganze Welt in Sekundenschnelle erreichbar gemacht.
Hier gelangt der soziale Kommentar in "Paris 2119" leider bereits an sein Ende und schlägt in eine beliebige Technikkritik um, wenn der aus der Zeit gefallenen Held Tristan Keys, dessen Nostalgie charmant rückwärtsgewandt wirken könnte, jedoch unweigerlich an affektiert aufgesetztes Hipstertum denken lässt, auf die Spur von Transcores finsterem Geheimnis kommt.
Die böse Offenbarung, eingeleitet von einer kuriosen Métro-Begegnung, ist dann so vorhersehbar, dass der melancholische Möchtegernermittler außerordentlich tumb wirkt. Dabei bleiben Tristan und seine Partnerin Chloé, deren unbesorgte Transcore-Nutzung sie als Akteurin zunehmend degradiert, in der Charakterzeichnung zu blass, um die Leser über die Handlungslängen hinweg zum jähen Finale zu tragen.
Diese Zukunftsvision erschiene letztlich ebenso antiquiert wie ihr Protagonist, drohte die nostalgisch eingefärbte Ennui nicht permanent in einen beinahe komischen Fatalismus umzuschlagen. Bertails Zeichnungen und vor allem Farbgebung ermöglichen es der zahmen Fortschrittsskepsis, sich selbst als tragische Ausbruchsphantasie zu entlarven, die auch im Happy End noch zum Scheitern verurteilt ist.
Die verspielten futuristischen Applikationen, die das vertraute Pariser Stadtbild ergänzen, können die saubere Tristesse der ersten Hälfte zwischen beigen Appartements und graubraunen Metroschächten nicht auflockern und trotz einiger Cyberpunktelemente stellt sich rasch das Gefühl ein, durch eine viel zu glatte Handlung ohne Akzente geschleust zu werden.
Erst als Tristan Keys aus der Gesellschaft ausbricht, weiten sich die Panels zu eindrücklicheren Szenerien von regennassen Pariser Straßen hin zu einer beinahe mystischen Nacht in London. Je weiter die Fassade von Tristans Welt bröckelt und in Verwirrung und Haltlosigkeit abdriftet, desto klarer werden ihre Umrisse, desto leuchtender ihre Farben und desto lebendiger und zugleich widerständiger die Hintergründe.
So rettet der beherzte Sprung vom Eiffelturm nicht nur den Helden in die Romantik eines Lebens als anonymer Outlaw, sondern erteilt zugleich dem zwischendurch fast zwanghaft wirkenden Realismus eine Absage, um sich in jenen mythischen Zustand zu flüchten, den Claude Lévi-Strauss, der im Comic sogar als Klon präsent ist, wildes Denken nennt.
Als Liebeserklärung an Paris visuell glaubwürdig, gelangt die Story dennoch nicht über das existentielle Entsetzen einer nachmittäglichen Métrofahrt hinaus. (HKB)
Cristin Wendts und Ronja Büschers "Message"
Cristin Wendts und Ronja Büschers "Message"

© Promo
Wie schwer es ist, pessimistische SF zu schreiben, ohne in die Widerholungsschleife derselben alten Klischees zu geraten, sieht man nicht nur bei Zep und Bertail sondern unter anderen Vorzeichen auch in Cristin Wendts und Ronja Büschers Debut "Message" (Band 1 von 5, Cross Cult, 80 S., 20 €).
Der Auftakt "Loading" lockt mit einem Zitat aus H. G. Wells' "The Time Machine" und verspricht Einsichten in eine postapokalyptische Zukunft, in der sich ein Computervirus, das eigentlich den Klimawandel bekämpfen sollte, gegen die Menschheit als dessen Urheber gewendet hat.
Trotz derart omnipräsenter Topoi tut sich der Band schwer damit, herauszustellen, inwieweit sich dieses Setting von zahllosen medienübergreifend ähnlich gestalteten Szenarien unterscheidet, in denen die Welt von maliziösen Maschinen in Schutt und Asche gelegt wurde, weil sich partout niemand an Asimovs Robotergesetze hält.
Weder die Figuren noch die mit einigen Ladehemmungen einsetzende Handlung können das Gefühl aufheben, das zwischen düster und schrill changierende Actionabenteuer schon einmal gelesen, gesehen oder gespielt zu haben.
Damit, dass es sich hier nur um einen ersten Band handelt, der nicht genug Raum zur Entfaltung lässt, hat das weniger zu tun als mit dem unausgewogenen Erzähltempo, das abwechselnd zu viele und zu wenige Informationen über Welt, Charaktere und alles, was auf dem Spiel steht, preisgibt.
So erfährt man über Avaraus, den reizbaren Helden der in dieser Hinsicht gnadenlos generischen Geschichte, kaum mehr, als dass er den vermeintlichen Tod seines Bruders nicht überwinden kann und nach Antworten sucht, und weder die Bildsprache noch die hölzernen Dialoge mit seinem Kumpel Quinn machen daraus mehr als eine abstrakte Plotmotivation.
Andererseits sind viele Szenen mit Technobabble überladen, das sich auf Handlung und Charakterentwicklung wie eine angezogene Handbremse auswirkt und dessen graphische Gestaltung in guten Momenten zum Verständnis beiträgt, in schlechten jedoch wirkt wie der Menühintergrund eines Videospiels.
Allgemein wirken sich intermediale Einflüsse nicht zum Vorteil aus. Die fahlrot-dunstige Wells-Hommage ist zwar der stimmungsvollste Moment im ganzen Band, erinnert aber zugleich daran, wie alt die Prämissen sind. Das gezielte Spielen mit Schärfe und Unschärfe verfehlt den angestrebten cineastischen Effekt, zumal das permanente Überschreiten von Panelgrenzen auf andere Art ebenfalls die dritte Dimension andeutet und so die Wirkung konterkariert.
Zumindest in dieser Hinsicht gehen Text und Bild hier Hand in Hand, täuschen sie doch beide eine Tiefe vor, die im Material eigentlich nicht vorhanden ist. (HKB)
Katrin Gals "Radius: Rebellion"
Katrin Gals "Radius: Rebellion"

© Promo
Dank geradliniger Erzählweise hat Katrin Gals "Radius: Rebellion" (Splitter, 96 S., 19,80 €) weniger Startschwierigkeiten, dafür hapert es hier in mehrfacher Hinsicht am Ton.
Der Einstieg in die auf vier Bände angelegte SF-Reihe über den Bürgerkrieg auf einem zweigeteilten Planeten versucht schon früh, durch den Einsatz von Metapanels die Dramatik der Lage einzufangen, hält den Detailreichtum der ersten Seiten aber nicht aufrecht und lässt insbesondere die Hintergründe außer Acht, deren verwaschene Farben das gesamte Erscheinungsbild schmälern.
Geradezu drollig sind zudem die oft karikativen Posen der Figuren – seien es die an einem Heilmittel feilenden Wissenschaftler, die verbissene Rebellenanführerin oder der intrigante Strippenzieher hinter den Kulissen –, die mit der vorgeblichen Ernsthaftigkeit des High-Tech-Actionspektakels so gar nicht harmonieren wollen.
Dass lockerflockig mit Begriffen wie „Säuberung“ und „natürliche Auslese“ hantiert wird, um dem Ausgangskonflikt mehr Bedeutung zu verleihen, fiele weniger negativ auf, wären diese genozidalen Untertöne nicht in eine verunglückte Allegorie auf antirassistische Bürgerrechtsbewegungen eingewoben, die, kaum ist die forcierte, aber dafür immerhin kompakte Exposition vorüber, fallengelassen wird.
Den auf kurzweilige Action gemünzten Comic mit zeitgenössischen Themen anzureichern, indem die unterdrückten Bewohner der ärmeren Planetenhälfte anfangs mit englischen Slogans wie „End Noble Supremacy“ oder „Human Values Do Not Depend On Skin and Hair Color“ zu sehen sind, ist bereits befremdlich.
Doch spätestens, wenn mit dem Alpha-Team die eigentlichen Helden auf den Plan treten und sich als Verkörperung generischer weißer Actionstereotype entpuppen, die sich fortan in soliden Kampfszenen mit den ebenso weißen Rebellen prügeln, ist der politische Unterton vollends verklungen und lässt ein schales Gefühl moralischen Trittbrettfahrens zurück. (HKB)
Enki Bilals "Bug"
Enki Bilals "Bug"

© Promo
Enki Bilal hat sich schon früh, nämlich 1979 mit "Exterminator 17" und ebenso regelmäßig in den 1980ern durch Reihen wie "Alexander Nikopol", an SF-Topoi bedient. 2018 veröffentlichte der zu Ruhm gekommene Veteran das IT-Crash-Szenario "Bug" (Carlsen, 88 S, 24 €).
Die Idee ist nicht sonderlich originell. Vielleicht wäre sie es aus metatextueller Perspektive, falls der Totalausfall aller Computersysteme Werke wie Bilas schwer CGI-gestützten Film "Immortal" aus dem Jahr 2004 unmöglich gemacht und er das selbstreflexiv mittels eines daran anknüpfenden autobiografischen Comics ausgeschlachtet hätte.
Dass sich alles digital gehortete und nach dem Zusammenbruch verlorengegangene Wissen in einem einzigen Menschen konzentriert, welcher daraufhin zur meistgejagten Person auf einer ins Chaos schlingernden Welt wird, macht "Bug" zu einem Selbstläufer für Bilal, der sonst eher mit dem begnadeten Szenaristen Pierre Christin zu Hochform auflief.
Als abgängig zu verzeichnen sind jedenfalls die Grenzen aufzeigenden Tuschlinien, um dem Hang der späten Jahre zum Einsatz von unter anderem Kohle und Direktkolorierung und damit einer allumfassenden Düsternis zu frönen. Fort ist zudem der Farbrausch einer Preziose wie dem mit Christin zusammen verfassten Treibjagd, einem absoluten Höhepunkt im Werkkatalog des Künstlers, voller Rottöne in blutdurchströmten russischen Dampfbädern sowie gülden schimmernden Turmkuppeln und Ikonenbildern umrankt von heiligen Auren.
In "Bug" wirken einige Panels wie reiner Selbstzweck, so die schwebenden Superreichen. Sie scheinen nur zu existieren, um möglichst Spektakuläres zu visualisieren und nähren den Verdacht, dass ein Zeichner, dessen Einzelseiten zu horrenden Preisen versteigert werden, genau auf einen derartigen Markt abzielt.
Andererseits, Bilals Film "Immortal" war beispielsweise trotz oder gerade wegen seiner den Blick befremdenden Ästhetik ansehnlich und interessant, und "Bug" entfaltet ebenfalls einen gewissen, wenngleich etwas aus der Zeit gefallen scheinenden Reiz.
Und dann blitzt plötzlich doch die alte Grandezza auf, spätestens beim Auftauchen von Koreas Staatsoberhaupt in Pjöngjang, der in seiner gläsernen Badekabine wie ein Wiedergänger Baron Harkonnens wirkt – was sich auf Auktionen garantiert lukrativ ummünzen lassen wird.
Es ist schwer vorhersehbar, ob und wie Bilal die Reihe auf die Reihe bekommt, aber zumindest hat er einen passablen Einstieg geschaffen, Ende 2019 soll es bereits weitergehen. (ORi)
Tsutomu Niheis "Aposimz"
Tsutomu Niheis "Aposimz"

© Promo
Wer ohne Zögern Captain Hook zu den Pionieren des Transhumanismus zählen würde, kann ebenso Tsutomu Niheis SF-Manga, angefangen bei "Noise"/"Blame" bis hin zu "Knights of Sidonia", als Meditationen innerhalb dieser Denkrichtung begreifen.
Also fast. Abzulesen ist an der Entwicklungsgeschichte der Werke des japanischen Mangaka die Faszination an Mutation, hybriden Lebensformen und latentem Sadomasochismus. Letzterer ist, vor allem in den Frühwerken bis circa "Abara", durch an die BDSM-Szene erinnernde Kleidungsstile der Protagonisten sowie deren Lust an Unterwerfung gegenüber einer fortwährenden Veränderung erkennbar – was stets Trennungsschmerzen von nur temporär Bestand habenden Lebensumständen und -formen impliziert.
Auch unterliegt die Geschlechtsbestimmung hier oft keinerlei Normativ mehr, wobei sich allerdings im Spätwerk Niheis ein leicht verklemmt wirkender pubertärer Humor breit zu machen beginnt, der sich vornehmlich in der Zurschaustellung sekundärer Geschlechtsmerkmale weiblicher Figuren in als humoristisch verklärten Situationen zeigt.
Im gleichen Zug, in dem sich Niheis einstiger Ansatz von enigmatischen und nicht-linearen Erzählstrukturen in eine leichter konsumierbare Richtung entwickelt, betreibt er, und das im neuesten Werk "Aposimz" (Cross Cult, bislang drei Bände, je 180/192 S., je 10 €) noch mehr als in der vorangegangenen Kampfroboter-Seifenoper "Knights of Sidonia", eine Demontage seiner grafischen Manierismen.
Seine ehedem in opaker Dunkelheit schwelgenden und mit dicken Tuschestrichen von massiver Wucht angelegten Bilderwelten bewegen sich auf eine nachgerade schwerelose Leichtigkeit zu, dabei die völlige Auflösung aller Konturen und Details forcierend.
Im Wesentlichen sorgt diese Vorgehensweise für einen avantgardistischen Subtext mittels einer minimierenden Verbildlichung, welche eine starke Nähe zum Genre des abstrakten Comics aufweist; vielleicht ist es aber gleichfalls eine der Arbeitsökonomie geschuldete Entscheidung.
Gleichzeitig bleibt Nihei dem Thema der ewigen Auseinandersetzung treu, um ausufernde Schlachten zwischen genetisch aufgerüsteten Hybriden, in "Aposimz" als Normpuppen und auf einem Eisplaneten lebend spezifiziert, zu inszenieren.
Das Nacherzählen der Handlung ist müßig, dient diese doch lediglich als Staffage. Wo der Künstler damit am Ende hin will, bleibt weiterhin abzuwarten, aber die Evolution der Grafik ist hier nicht nur Selbstzweck, sondern ebenso immanenter Bestandteil des Oberthemas der menschlichen Auflösung. (ORi)
Mickey Zacchillis "Space Academy"
Mickey Zacchillis "Space Academy"

© Promo
Während Tsutomu Nihei die Auflösung seines Stils in ein seltsames Konglomerat aus Wohlgefallen und abstrakte Formen vorantreibt, scheint Mickey Zacchilli mittels ihrer ursprünglich auf Instagram gestarteten Serie "Space Academy" (Koyama Press, 216 S., ca. 16 €) – welche Ende 2018 auch in gedruckter Form erschien und aus lose zusammenhängenden, aber ebenso einzeln lesbaren Strips besteht – einen stilistisch-taktischen Schlag ins Gesicht effekthascherischer SF-Comics wie beispielsweise "Message" ausführen zu wollen.
Die Reduktion bzw. Auflösung von Standardthemen über die visuelle Erzählkomponente, die Anleihen bei Manga und Kunstcomics macht, aber den Weg in die Abstraktion bzw. die von Nihei in dessen letzten Werken praktizierte Emanzipation von dem Anspruch, Formen überhaupt entschlüsseln zu wollen, betreibt Zacchilli, indem sie alles skizzenhaft darstellt, aber auf stets einfach identifizierbare Grundmuster zurückführt.
Ebenso eine Pionierin innerhalb des Felds der im Risograph-Verfahren gedruckten Comics, in dem auch die Produktion von Kleinstauflagen bei geringem Aufwand möglich ist, erzählt Zacchilli aus dem Jahr 2155, dabei an den Titel einer SF-TV-Serie für Kinder aus den 1970er Jahren erinnernd, von jungen Leuten, die in einer Weltraumakademie ausgebildet werden, deren weiteres Personal aus Robotern und Computern besteht.
Dies ist nahe an den "Peanuts" mit deren Verquickung zwischen Komik und philosophischen Untertönen sowie eine Schwester im Geiste von Aminder Dhaliwals Strip "Woman World", ebenfalls einst auf Instagram debütierend, in dem unaufgeregt auch schon mal Banales Eingang findet.
Auf den ersten Blick eher improvisiert erscheinend, macht genau dies den Charme von Zacchillis Serie aus, und bei genauerem Hinsehen erweist sich ihre Meisterschaft darüber hinaus darin, mit wenigen Strichen von unterschiedlicher Stärke die Wandlungen der Gemütszustände ihrer Figuren besser einzufangen als so manch renommierter und dem Expressionismus zugeschlagener bildende Künstler. (ORi)
Shintaro Kagos "Parataxis"
Shintaro Kagos "Parataxis"

© Promo
Das Bestreben, Shintaro Kagos "Parataxis" (Cross Cult, 192 S., 20 €) als „wahnsinnige Cyber-Fantasien“ zu bewerben, wirkt ähnlich hilflos wie die Versuche der Verlagsbeschreibung, das erste – die 2009 im "Orang"-Magazin veröffentlichte Kurzgeschichte "Rubik’s Cube" nicht mitgerechnet – auf Deutsch zugängliche Werk des Ero-Guro-Mangaka hastig in posthumanistische Diskurse einzubetten.
Beide Reaktionen sind als reflexartige Entschärfungsmaßnahmen nachvollziehbar, vermindern jedoch mit dem Verstörungspotential zugleich auch die Stärken der bereits 1997 in Japan erschienenen Geschichtensammlung.
Von Wahnsinn kann bei der raffinierten Erzählweise, durch die sich aus den scheinbar unzusammenhängenden Episoden eine einzige große Momentaufnahme zusammensetzt, ohnehin keine Rede sein. Ob Gehirnpresse oder Raupenfarm, die wie zufällig eingestreuten skurrilen Elemente in Kagos schwarz-weißen Entwürfen arbeiten alle bereits auf das letzte Gesamtbild hin, den Untergang einer Welt, die es so nie hätte geben dürfen.
Diese unmögliche Gesellschaft, in der Menschen die Körper riesiger Humaniode finden, ausschlachten und mit Maschinen verbauen, entsteht völlig frei von zwanghaften kulturkritischen Allegorien und entzieht sich so den gängigen dystopischen Auslegungen.
Auch gibt es kein zögerliches Verwischen der Grenze zwischen Mensch und Maschine, das die Leser*innen mit plumpen moralischen Denksportaufgaben konfrontiert. Die unmittelbare Tatsächlichkeit, mit der einem Parataxis entgegentritt und die Spannung zwischen Weltschmerz und lustvollem Ausreizen des Grundkonzepts aufrechterhält, gilt es erst einmal auszuhalten.
Dazu gehört auch, dass sich die schraffierte Umgebung aus Schaltkreisen und monströsen Technikhybriden gelegentlich in den Vordergrund drängt. Durchzogen von Maschinen, Rohren und Kabel lässt sie ihre Figuren geradezu winzig wirken, was natürlich zum Konzept gehört.
Die Größenunterschiede spürbar zu machen ist allgemein die Crux des Settings, und Kago brilliert darin. Bei allem Body Horror, dessen drastische Gewaltexzesse auch vor makrophilen Fetischmomenten und kannibalistischen Phantasien nicht Halt machen, wird die größte Wirkung aber letztlich dort entfaltet, wo vertraute Elemente die groteske Fremdheit durchbrechen: Tragikomische Figuren, die in die Welt geworfen werden und am eigenen Dasein verzweifeln. (HKB)
Paul Paetzels und Marc Hennes' "Gaia 7"
Paul Paetzels und Marc Hennes' "Gaia 7"

© Promo
Nach dem Kalauer „gaiafucking“ kommt für einen Moment die Befürchtung auf, dass sich Paul Paetzel und Marc Hennes als nächstes zu „Gaia Sturzflug“ versteigen könnten. Schließlich hat in ihrem Comic "Gaia 7" (Colorama, 88 S., 22 €) ein sich in Turbulenzen befindliches Raumschiff eine gewichtige Rolle inne – andererseits würden dieses Wortspiel eh nur Überlebende der achtziger Jahre goutieren.
Zudem sind Paetzel und Hennes, beide Alumni des renommierten Illustrators Henning Wagenbreth mit Professur an der Universität der Künste in Berlin, gar nicht daran interessiert ihren SF-Trash in deutscher Sprache zu publizieren, sondern, und damit folgen sie einem ansteigenden Trend in der alternativen Comic-Szene, erledigen den Job devotedly in englischer Sprache.
Denn wen sollte diese bizarre Mischung aus der seit 2016 erscheinenden futuristischen Comic-Gewaltgroteske "Space Riders", welche dem US-amerikanischen und experimentierfreudigen Black-Mask-Studios entstammt, und einer aus der Reihe tanzenden Zeichentrick-Serie namens "Thundarr, the Barbarian", entstanden 1980 unter der Mitwirkung illustrer Namen wie Steve Gerber, Alex Toth und Jack Kirby im Zuge der Wiederentdeckung der Conan-Romane Robert E. Howards und vor allem deren erfolgreiche Adaption durch Marvel-Comics Ende der 1970er, in Deutschland auch interessieren?
Die Geschichte um zwei Socken, die ein Raumschiff samt Besatzung sabotieren, weil sie den an Bord befindlichen König Noldda umbringen wollen, erzählen Paetzel und Hennes abwechselnd. Wo Hennes einen sehr liquiden Stil irgendwo zwischen Lasse Wandschneider und Julien Ceccaldi etabliert, konterkariert Paetzel dies mit bodenständiger Action, deren Wurzeln sich eben auch auf Jack Kirbys breitbeinig daherkommende Epen zurückführen lassen.
Dieses Flirren zwischen being arty und brachialer Prägnanz trägt die schablonenartige Bausatz-Schnurre gut durchs All, bis hin zu vernebelten Planeten, die als Rückzugsort strippenziehender Intriganten dienen.
Der bereits bei "Thundarr, the Barbarian" überzeugend inszenierte Rückfall in prä-zivilisatorische Gepflogenheiten vor von High-Tech-Relikten durchdrungenen Kulissen steht auch "Gaia 7" ganz gut – woran ein erklecklicher Schuss Sex ebenfalls einen Anteil hat.
Deshalb gibt es mit erigierten Penissen dekorierte Bondage-Szenen und Masturbation zu ebensolche Inhalte verhandelnden Comics, damit Metaebene nebst seitenkompositorischem Anspruch Berücksichtigung finden, und wer spätestens da nicht kommt, kommt eben gar nicht. (ORi)
Was kommen wird
Die wichtigsten SF-Comics 2018/19 bedienen von Weltraumaventüren zu Zombieapokalyptik, von posthumaner Zukunftshoffnung zu technikskeptischer Zukunftsangst eine erstaunliche thematische Bandbreite. Dabei fällt durchaus auf, dass Innovationen und neue Impulse aktuell gerade von dem Teil der jüngeren Generation kommen, der wenig Interesse zeigt, sich bei vermeintlichen Genreinstanzen anzubiedern. Überraschend viele Newcomer trauen sich, von Neuerzählungen der immer gleichen Narrative abzusehen und eigenem wie eigenwilligem Stil neue Perspektiven einzubringen.
Die Entwicklung hin zu mehr Diversität und Experimentierfreude im Sujet stimmt wohlgemut, wäre da nicht der stetige Backlash reaktionärer Provenienz. Aber Fortschritt muss immer gegen Widerstände durchgefochten werden – oder weniger martialisch und nicht im schwertschwingenden Barbaren- oder Sternenkrieger*innen-Modus sondern mit Bradbury formuliert: there will come soft rains, es werden leise Regen kommen.
Der Schirm, den wir aufspannen, muss allen Platz bieten, die sich darunter versammeln wollen, damit wir nicht weiter in eine Dystopie hineinschlittern, die längst ihr hässliches Haupt erhoben hat, und alles von einer willkürlich festgesetzten Norm ausgehend Abweichende mundtot, an den Rand drängen, und letztlich ausmerzen will. Die SF wäre so nur noch ein literarischer Planet der Habenichtse, auf dessen Oberfläche nichts mehr über die schillernde Vielfalt eines alle möglichen, aber nicht exkludierenden Denkrichtungen beherbergenden Lebens sagbar wäre.
Und der Comic? Er käme daher als ein um viele Bilder und Zeichen ärmeres Behelfskonstrukt, gleich einem Raumschiff, das nie sang.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false