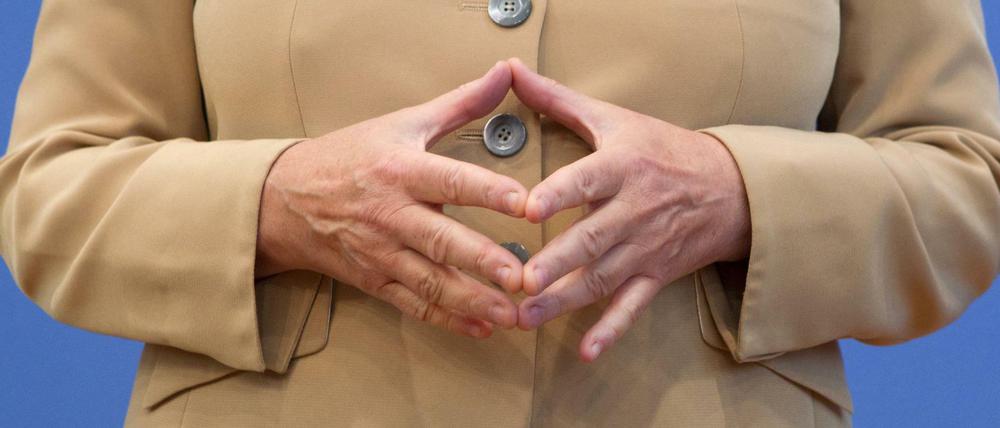
© dpa/Michael Kappeler
Außenpolitik im neuen Bundestag: Die SPD ist das Risiko, nicht die AfD
Die SPD geht in die Opposition. Damit endet der Konsens in der außenpolitischen Auseinandersetzung. Sie wird polemischer und polarisierter. Ein Kommentar.

Wird sich der Einzug der AfD wirklich als das epochale Ereignis für den neuen Bundestag erweisen? Für die außenpolitische Debatte darf man das bezweifeln. Folgenreicher wird der Gang der SPD in die Opposition sein. Eine Ära weitgehenden Konsenses über Deutschlands internationale Rolle geht zu Ende. Die Auseinandersetzung wird kontroverser, populistischer, polarisierter.
Die AfD hat kein außenpolitisches Programm
Die AfD hat keine durchdachten Positionen zu den klassischen und aktuellen Fragen der Außenpolitik: transatlantische Beziehungen, Umgang mit China, dem Nahen und Mittleren Osten, Atomkonflikt mit Nordkorea. Allenfalls sticht ihre freundliche Rhetorik gegenüber Russlands autoritärem Präsidenten Putin heraus und ihre Indifferenz in Menschenrechtsfragen; da gleichen die Reflexe der Rechtsaußen denen der Linksaußen. Prononcierte Haltungen vertritt die AfD nur bei ihren Spezialthemen Migrationspolitik und Eurokrise. Die fallen in den Bereich europäischer Innenpolitik.
Die SPD hingegen wird künftig, wenn es erwartungsgemäß zu einer Jamaika-Koalition kommt, mit der Linken darum konkurrieren, wer die lautere Gegenstimme zur Regierung ist. Die außenpolitische Debatte wird sich zuspitzen. Das ist per se nicht schlecht. In den vergangenen Jahren wurden außenpolitische Fragen zu selten öffentlich durchdekliniert mit ihren Pros und Contras, Chancen und Risiken. Die Kanzlerin machte; den Wählern wurde kaum erklärt, was auf dem Spiel steht.
Der amtierende Außenminister nennt Nato-Beschlüsse "irre"
Mit der neuen Konstellation sind freilich Risiken verbunden, ganz voran die Versuchung, außenpolitische Kontroversen nicht redlich mit Argumenten auszutragen, sondern künstlich zuzuspitzen bis hin zur populistischen Spaltung der Gesellschaft. Die Emotionen lassen sich leicht instrumentalisieren, weil die Regierung es mit Partnern zu tun hat, die aus gutem Grund umstritten sind: ganz voran US-Präsident Donald Trump, aber auch Recep Erdogan in der Türkei, Wladimir Putin in Russland, Benjamin Netanjahu in Israel.
Der Wahlkampf hat bereits Hinweise auf diese Versuchungen gegeben. Der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel nannte die Selbstverpflichtung des Nato-Mitglieds Deutschland, zwei Prozent des BIP in Verteidigung zu investieren, „irre“ – eine Vereinbarung, die SPD-Regierungsmitglieder mehrfach mitbeschlossen haben. Statt zu argumentieren, ob dieses Ziel für den Exportweltmeister, der am meisten von sicheren Handelsrouten profitiert, weiter sinnvoll ist oder nicht und wie man es gegebenenfalls erreicht, spitzte Gabriel emotional zu: Man solle Trump diesen Gefallen nicht tun.
Das Zwei-Prozent-Ziel ist älter als Trump, es geht dabei auch nicht um Trump, sondern um deutsche Interessen. Deutschland hat 2014 begonnen, den Verteidigungsetat zu erhöhen, wegen Putin und dem Krieg in der Ukraine.
Der populistische Antiamerikanismus kehrt zurück
Der Versuchung, die nachvollziehbare Anti-Trump-Stimmung als neue Spielart des klassischen Antiamerikanismus zu nutzen, gab Gabriel auch beim Blick auf Nordkorea nach. Der Kern seiner Botschaft: die Welt habe es mit zwei gefährlichen Verrückten zu tun, Kim Jong Un und Trump; womöglich sei Trump die größere Bedrohung. Tatsächlich sieht der UN-Sicherheitsrat in Kim die Gefahr und den Rechtsbrecher; er setzt sich über das Verbot der Atom- und Raketentests hinweg. Trumps Twitter-Äußerungen sind gewiss nicht hilfreich für eine Lösung. Ein Outlaw wie Kim ist Trump aber nicht.
Martin Schulz hatte es im Wahlkampf noch abgelehnt, die Kriegsgefahr in Korea für die innenpolitische Mobilisierung zu nutzen. Bleibt er dabei oder gilt nun auch hier: Wir werden sie jagen?
Der SPD mangelt es an erfahrenen Außenpolitikern
Hinzu kommt der Mangel erfahrener Außenpolitiker in der SPD-Bundestagsfraktion. Gabriel gehört eigentlich nicht dazu, Schulz’ Erfahrung beschränkt sich auf die EU. Da bleiben Niels Annen, Rolf Mützenich, Dietmar Nietan. Wer hat die Statur, um die SPD von populistischen Exzessen in der Außenpolitik abzuhalten?
Jamaika hält weitere Neuerungen bereit, darunter vermutlich den ersten türkischstämmigen Bundesaußenminister. Wie wird Cem Özdemir seine speziellen Landes- und Sprachkenntnisse einsetzen? Und wie werden die Grünen generell ihren Einsatz für die Menschenrechte mit der unvermeidbaren Realpolitik versöhnen? Von den Liberalen sind international weniger Impulse zu erwarten. Genschers Partei setzt unter Christian Lindner andere Prioritäten: Finanzen, Steuern, Digitales.
Das Ausland blickt vor allem auf die Kanzlerin. Sie wird als entscheidende Stimme betrachtet, auch in der Außenpolitik. Populistische Gegenoffensiven im Bundestag werden im Ausland gleichwohl die Frage erneut aufkommen lassen, wie verlässlich dieses neue Deutschland im Westen verankert ist.
Christoph von Marschall arbeitet derzeit in Washington an einer Studie über die Zukunft der Transatlantischen Beziehungen als erster Helmut-Schmidt-Fellow der Zeit-Stiftung und des German Marshall Fund of the United States.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid:
- showPaywallPiano:
- false